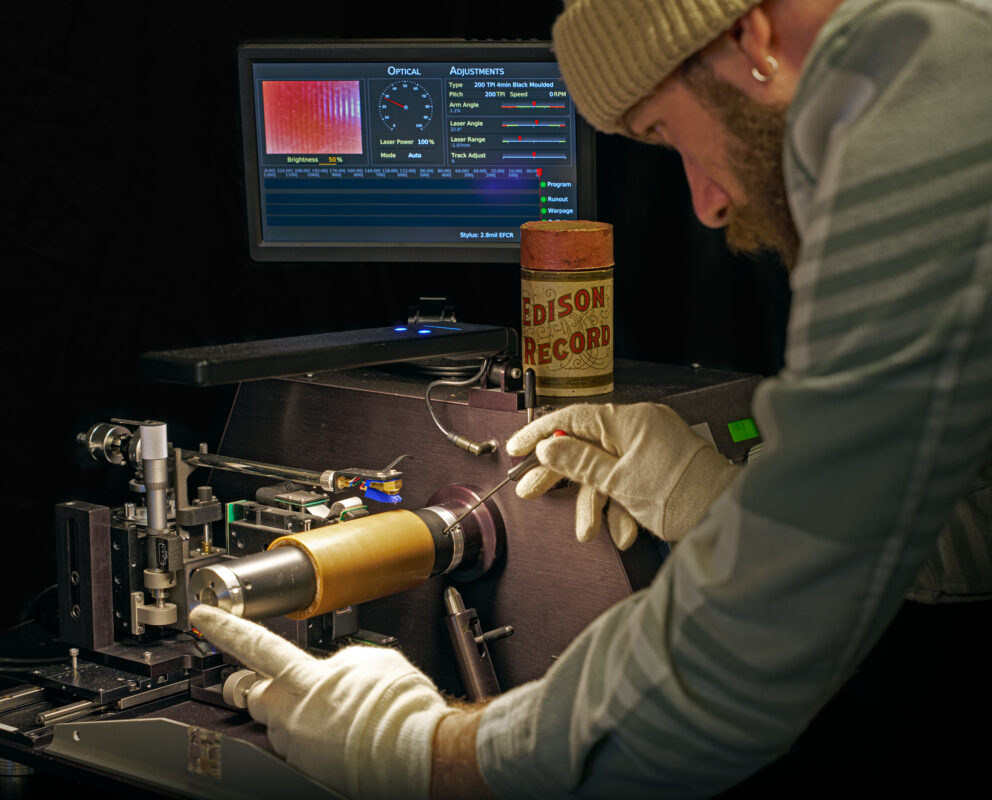Mit den Augen der Lernenden
Als ich 2024 die Leitung des neuen Masterstudienganges Musik und Szene in Transformation in Basel übernahm, begleitete mich schon eine Weile das Buch «Mit den Augen der Lernenden» der katalanischen Philosophin Marina Garcés.
Bereits im Klappentext geht es ums Ganze: Was nützt Wissen, «wenn wir nicht wissen, wie wir leben sollen? Warum lernen, wenn wir uns die Zukunft nicht vorstellen können?».
Bildung sei das Substrat unseres Zusammenlebens, der Kampfplatz, an dem die Ressource Bildung mehr ausgebeutet werde als Spielort zu sein, an dem neue Lebensformen erprobt werden können. Garcés indessen schwebt eine Werkstatt vor, in der sich lebenslanges Lernen nicht an der Not, nämlich zum Experimentieren unter neoliberalen Leistungsimperativen gezwungen zu sein, orientiert, sondern einer Einladung gleichen müsse. Einer Einladung, «das Risiko des gemeinsamen Lernens einzugehen, gegen die Kräfte der eigenen Zeit.»
Herrschaft des Talents und Logik der Zwei
Musikhochschulen sind Orte des Talents. Orte, an denen bereits in der Eignungsabklärung geklärt wird, ob sich weiter der Herrschaft des Talentes zu folgen lohnt, oder ob bereits zu einer anderen Karriere und einem alternativen Lebensweg geraten werden muss. Mit dem Begriff der Herrschaft des Talentes beziehe ich mich auf den amerikanischen Literaturwissenschaftler und Psychoanalytiker Eric L. Santner der herausarbeitete, wie in der Perfektionierung unserer Talente auch ein Potential zur Unfreiheit liegen kann. Musikhochschulen sind auch Orte einer Logik der Zwei. Die Meister:innen besitzen etwas, das in einem meist linearen Wissenstransfer weiterzugeben eine:n historisch informierte:n Interpret:in im Blick hat. In diesem Transfer scheinen wir zu wissen, für wen oder was wir ausbilden: für einen Lebensbereich, den wir selbst bereits besiedelten. Einen Lebensbereich, den wir uns vielleicht sogar selbst erkämpfen mussten über Wettbewerbe, Preise, Auswahlverfahren. Nicht nur in diesen kompetitiven Ausbildungsbereichen, sondern in der Gesellschaft im Ganzen scheint kaum Platz für eine Werkstatt, in der gemeinsam gebastelt, gebaut, gestolpert und entworfen werden kann. Mit Marina Garcés gesprochen: Es fehlt die Zeit, in der wir langsam, organisch wachsen können. Wir sind nervös und brauchen schnelle Lernerfolge. Statt einen Garten anzulegen, in dem wir neue Pflanzen und Kräuter kombinieren, einen Ort gestalten, der nicht nur bestellt, sondern ganz Archipel ist und an dem es sich zu leben lohnt, kann die Logik der Zwei zu einer Monokultur führen. Vielleicht sogar Reservat werden, in dem abgesteckt, die Lebensformen getrennt voneinander existieren sollen. Ersetzen wir den Begriff der Lebensformen durch künstlerische Disziplinen, so besteht die Gefahr, dass wir auch die künstlerischen Disziplinen als Monokulturen anlegen.
Polyphone Werkstatt
Künstlerische Ausbildung ist aber ein Ort der Drei. Zwischen lehrender und lernender Person existiert ein drittes Objekt, eine gemeinsame Fragestellung, These, Konflikt oder Sorge, an der gemeinsam zu arbeiten lohnt. Hier entsteht ein drittes Wissen, radikal subjektiv, aber geboren aus einem gemeinsamen Interesse, jenseits nackter Anforderungen des Marktes.
Dieser Ort eines dritten Wissens ist eine Werkstatt, keine Fabrik. In Basel sprechen wir von polyphonen Werkstätten, einem Begriff, den ich mir von Clemens Risi und David Roesner entliehen und mit den Studierenden weiterentwickelt habe. Hier geben wir Veränderung Raum, weil sie Teil des Lebens ist. Im ersten Jahr Musik und Szene in Transformation sind in diesen Werkstätten Projekte für den öffentlichen Raum entstanden, Performances zur Figur der Hexe als feministischer Figur und neue Konzert- und Performanceformate in Form von Musikinstallationen. Wir haben uns mit Raum- Körper-Zeitmusiken beschäftigt und einen Student Campus initiiert. Wir haben über Musik als temporäres Ritual in politischen Kontexten nachgedacht, Musik, Gedenkkultur und Erinnerungspolitik im Rahmen von 80 Jahre Kriegsende in Europa beim Friedensfest Augsburg untersucht oder ein Bankräuberorchestra im Rahmen des Basel Social Clubs gegründet, welches während der Art Basel in einer leerstehenden Bank Musik, die oft zu Repräsentationszwecken genutzt wurde, kritisch kontextualisierte.
Emanzipierte Interpret:innen
Immer wieder wurde in den letzten Jahren von der Notwendigkeit gesprochen, dass sich klassische Musikhochschulen in ihren Lehrangeboten an einem immer komplexer und immer härter umkämpften Markt orientieren und ihre Lehrangebote dementsprechend modellieren müssen. Die Studierenden sollen mehr und mehr zu Zehnkämpfer:innen werden, anstelle sich in einer Disziplin zu professionalisieren, oder am besten beides. Mehr und mehr Tools und zusätzliche Qualifikationen sollen erworben werden, damit sie flexibel auf neue berufliche Herausforderungen reagieren können. Hier scheint ein seltsamer Druck am Werke, sich verschiedene andere Disziplinen mehr anzueignen, anstatt mit und in ihnen zu lernen. Um diesen Kampf kann es uns nicht gegangen sein, als wir die künstlerisch-musikalische Lehre in Richtung Transdisziplinarität weiterdenken wollten. Vielmehr muss es darum gehen, den historisch informierten Interpret:innen emanzipierte Interpret:innen zur Seite zu stellen. Nicht zur Ablösung, sondern als Gefährt:innen. Emanzipiert sind diese, weil sie, zusätzlich zum Erlernen klassischen Repertoires, ermutigt werden, gemeinsam mit Kommiliton:innen und lehrenden Personen an einem ganz eigenen, dritten Wissen zu forschen. Dieses Wissen ist wichtig, weil wir uns damit – wieder mit Marina Garcés gesprochen – eine Zukunft vorstellen können. Eine gemeinsame Zukunft, jenseits der Vereinzelung, die sich beinahe unbemerkt durch die auf den Einzelnen fokussierte Herrschaft des Talents und des Wettbewerbs in die künstlerische Ausbildung geschlichen hat. In Basel haben wir einen Anfang gemacht. Experimentell und offen für Kooperationen und gleichzeitig eingebettet in die bereits existierenden Institute der Hochschule.