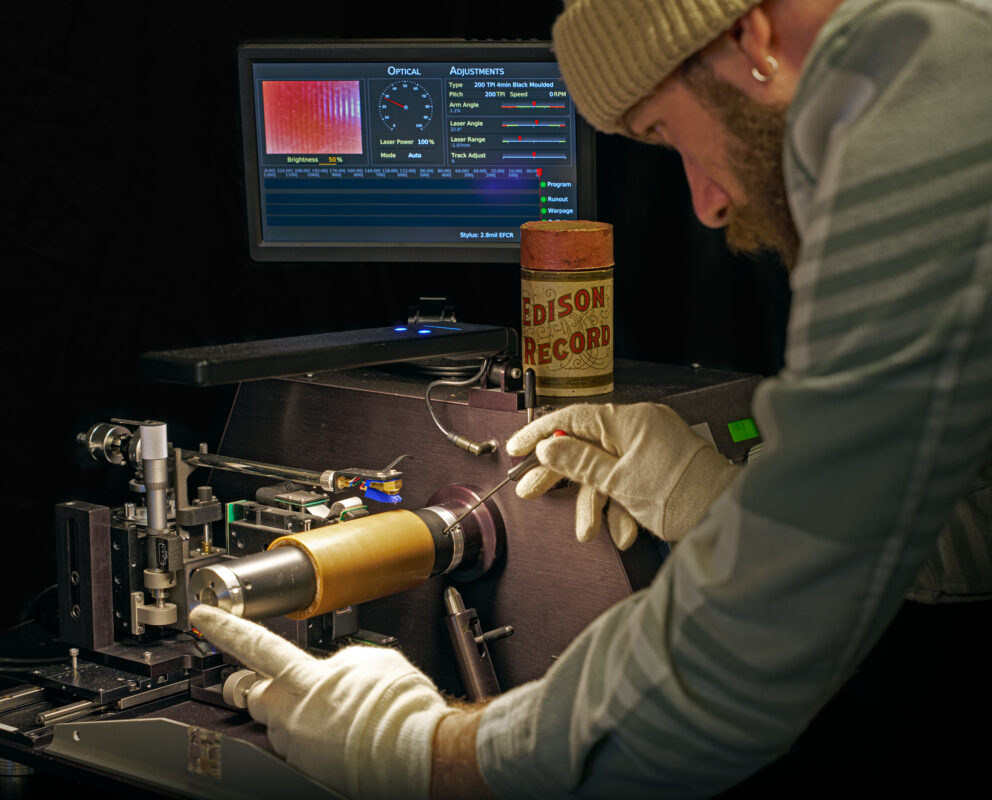Vom Mythos des schönsten Berufs
Musikerinnen und Musiker hören oft, sie sollten sich glücklich schätzen, sie hätten ja den schönsten Beruf der Welt. Die Realität ist allerdings eine andere.
Das Narrativ ist hartnäckig: Die Pandemie war für die «beruflich erfülltesten Menschen», die Musikerinnen und Musiker, eine Durststrecke. Sie konnten ihren Beruf kaum mehr ausüben und mussten, vor allem als Freischaffende, mit grossen Existenzängsten kämpfen. Nun aber ist das alles ja wieder vorbei, und das schöne Leben kehrt für sie zurück. Sie können ihr wunderbares Hobby wieder zum Beruf machen, als Menschen, die – anders als gewöhnlich Sterbende – ihre Persönlichkeit mit ihrem Berufsalltag in Einklang bringen können.
An der Vorstellung, dass Musik die positiven Emotionen bestärkt und zu einem erfüllenden Alltag verhilft, zweifelt die Musikpsychologie schon länger. Der an der schwedischen Uppsala Universität lehrende renommierte Musiksychologe Patrik N. Juslin mahnte schon 2013 an, wir sollten «offener für die Möglichkeit sein, dass vieles von dem, was musikalische Erfahrungen einzigartig macht, in Tat und Wahrheit nicht-emotionale Aspekte sind», etwa das intellektuelle Interesse an musikalischer Struktur oder Form. Die emotionale Wirkung von Musik sei davon weitgehend abgekoppelt.
Aktuelle Studien scheinen darauf hinzuweisen, dass sogar eher das Gegenteil dessen gilt, was bisher Klischee schien: Musizieren bedeutet in Wirklichkeit nicht nur aussergewöhnlichen beruflichen und sozialen Stress, an dem nicht wenige zerbrechen. Sie scheint auch eher Persönlichkeiten zu faszinieren, die ein höheres genetisches Risiko für emotionale Unausgeglichenheit haben. Dies zumindest lassen Studien vermuten, die ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt am Main durchgeführt hat. Ihr Fazit: Musikalisch aktive Personen haben im Durchschnitt ein etwas höheres genetisches Risiko für Depressionen und bipolare Störungen.
Musik und psychische Probleme
2019 konnte das Team laut dem MPIEA in einer grossen Populationsstudie erstmals einen Zusammenhang zwischen musikalischem Engagement und psychischen Problemen nachweisen: Rund 10‘500 schwedische Versuchspersonen hatten sowohl Auskunft über ihre musikalischen Aktivitäten als auch über ihr psychisches Wohlbefinden gegeben. Zusätzlich wurden die Daten mit dem schwedischen Patientenregister verknüpft, so dass auch psychiatrische Diagnosen ausgewertet werden konnten. Dabei kam heraus, dass musikalisch Aktive tatsächlich häufiger über depressive, Burn-out- und psychotische Symptome berichteten als solche, die keine Musik machten. Die Ergebnisse wurden in der Open-Access-Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.
In der Folge erweiterte das Team seine Forschung um Methoden der Molekulargenetik. Dabei fand es heraus, «dass sich genetische Varianten, die psychische Probleme beeinflussen, und solche, die auf musikalisches Engagement einwirken, teilweise überschneiden». Dabei konnten individuelle Indikatoren für das genetische Risiko für psychische Erkrankungen sowie die genetische Veranlagung für Musikalität berechnet werden.
Die Auswertung der Daten zeigte, dass Personen mit einem höheren genetischen Risiko für Depressionen und bipolare Störungen im Durchschnitt häufiger musikalisch aktiv waren, mehr übten und Leistungen auf einem höheren künstlerischen Niveau erbrachten. Interessanterweise, schreibt das MPIEA weiter, traten «diese Zusammenhänge unabhängig davon auf, ob die Personen tatsächlich psychische Probleme hatten».
Zur Überwindung solcher veranlagungsbedingten psychischen Belastungen scheinen Flow-Erfahrungen (Zustände, die empfunden werden, wenn man komplett in einer Tätigkeit aufgeht) eine bedeutende Rolle zu spielen. Erste Ergebnisse zeigen laut dem Institut, dass sie selbst unter Berücksichtigung familiärer und genetischer Risikofaktoren einen positiven Einfluss auf die Psyche haben können.
Literatur
Patrik N. Juslin: «From every day emotions to aesthetic emotions: Towards a unified theory of musical emotions», Physics of Life Reviews 10 (2013), Elsevier.
Wesseldijk, L. W., Lu Y., Karlsson, R., Ullén, F., & Mosing M. A. (2023). «A Comprehensive Investigation into the Genetic Relationship between Music Engagement and Mental Health», Translational Psychiatry 13, Article 15. DOI: 10.1038/s41398-023-02308-6