Komponistinnen im 19. Jahrhundert
Das Ensemble Les Métropolitaines präsentiert zum 200. Geburtstag von Clara Schumann-Wieck Lieder und Kammermusik von ihr und ihrem musikalischen Freundes- und Einflusskreis.
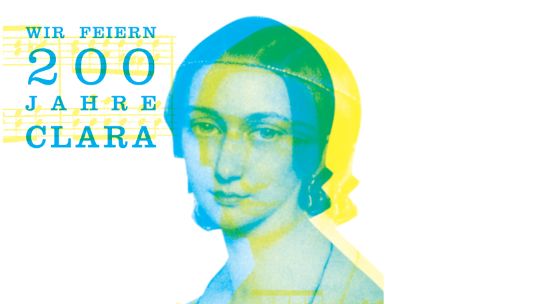
«Ich spiele nicht nur Klavier …» betitelte 2016 der Sender SWR2 eine Musikstunde, die komponierende Frauen verschiedener Jahrhunderte portraitierte. Das Klavierspiel, sozusagen die Grundausstattung einer Tochter aus gutem Hause, ist meist einer der Schwerpunkte der Komponistinnen im 19. Jahrhundert. Sie treten als Pianistinnen auf und erteilen Klavierunterricht, aber eben nicht nur, sie komponieren auch für dieses Instrument. Daneben erhalten sie oft Gesangsunterricht und begleiten sich dann selbst am Klavier. So wächst auch der zweite Kompositionsschwerpunkt, das Lied, aus dieser häuslichen Musiktradition heraus.
Viele der Komponistinnen, die wir für unser Konzert zu Ehren von Clara Schumann ausgewählt haben, sind in ihrer Familie mit weiblichen «Vorbildern» aufgewachsen, die in der Öffentlichkeit als Musikerinnen aufgetreten sind. Clara Schumanns Mutter, Marianne Tromlitz, trat solistisch in den Leipziger Gewandhauskonzerten auf. Claras langjähriger Freundin, Pauline Viardot Garcia wird das Singen sozusagen in die Wiege gelegt: Ihr Vater ist Operntenor und Komponist, ihre Mutter Sängerin und Schauspielerin. Nach dem Tod ihrer älteren Schwester, der berühmten Sängerin Maria Malibran, tritt die zunächst als Pianistin ausgebildete Pauline dann in die Fussstapfen ihrer Schwester. Josephine Langs Mutter ist ebenfalls Sängerin. Und auch Fanny Hensel und Mary Wurm haben Mütter, die ihren Kindern selbst Unterricht erteilen und für eine solide musikalische Ausbildung sorgen.
Wenn auch mit der Musik vertraut und eng verbunden mit Frauen, die ihren Beruf als Musikerinnen öffentlich ausüben, betreten die Komponistinnen mit ihrer Tätigkeit Neuland. Komponieren gilt nicht als Frauensache. So schreibt der Kritiker Hans von Bülow: «Reproductives Genie kann dem schönen Geschlecht zugesprochen werden, wie productives ihm unbedingt abzuerkennen ist. Eine Componistin wird es niemals geben, nur etwa eine verdruckte Copistin. Ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes: Schöpfer. In den Tod verhasst ist mir ferner alles, was nach Frauenemancipation schmeckt.»
Clara Schumann
Clara Schumann sieht sich selbst primär als Pianistin. «Ich fühle mich berufen zur Reproduction schöner Werke […]. Die Ausübung der Kunst ist ja ein grosses Teil meines Ichs, es ist mir die Luft, in der ich athme.» Ihre eigenen Kompositionen bewertet sie zum Teil als wenig geglückt. «[…] natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an der Kraft und hie und da an der Erfindung fehlt.» Und: «Componieren aber kann ich nicht, es macht mich zuweilen ganz unglücklich, aber es geht wahrhaftig nicht, ich habe kein Talent dazu.» Ihre Begründung: «Frauen als Komponisten können sich doch nicht verleugnen, dies laß ich von mir wie von anderen gelten.» Daneben gibt es auch Aussagen, die Freude an den eigenen Kompositionen zeigen: «Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben und dann zu hören.»
Robert schätzt Claras Kompositionen, er ermahnt sie zum Teil, das Komponieren nicht zu vernachlässigen. Er sieht auch bedauernd, dass sie neben den vielen Aufgaben nicht zum Komponieren kommt. «Clara hat eine Reihe von kleineren Stücken geschrieben, in der Erfindung so zart und musikreich, wie es ihr früher noch nicht gelungen. Aber Kinder haben und einen immer phantasierenden Mann und komponieren, geht nicht zusammen. Es fehlt ihr die anhaltende Übung, und dies rührt mich oft, da so mancher innige Gedanke verloren geht, den sie nicht auszuführen vermag.» In diesen Zeilen erscheint Clara als ernst zu nehmende Komponistin. Eine Lösung für das Problem wird allerdings nicht gesucht. Und wenn die beiden direkt in Konkurrenz treten, ist es mit der Gleichberechtigung vorbei. Robert leidet, wenn Clara auf Konzertreisen im Zentrum steht. Auf einem Doppelmedaillon will Robert über Clara abgebildet sein, weil der produktive Komponist über der reproduzierenden Künstlerin steht. Dass sich hinter der vordergründigen Ebenbürtigkeit eine klare Hierarchie verbirgt, zeigt sich auch im Zitat von Franz Liszt: «Keine glücklichere, keine harmonischere Vereinigung war in der Kunstwelt denkbar, als die des erfindenden Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräsentierenden Komponisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden Virtuosin.»
Pauline Viardot
Für Pauline Viardot sind schaffende und ausübende Künstlerinnen und Künstler gleichwertig. « […] der dramatische Künstler muss fortwährend schaffen – er muss menschliche, lebendige, fühlende, leidenschaftliche, vollendete, bis in den kleinsten Details naturwahre Gestalten sich erdenken und dem Zuschauer vorführen. Vor allem verehre ich den schaffenden Meister, unmittelbar neben ihm den schaffenden Künstler. Beide sind unzertrennbar – denn Jeder allein für sich bleibt stumm, und zusammen schaffen sie den höchsten und edelsten Genuss des Menschen, die Kunst.» Pauline kann beide Seiten intensiv durchleben, sie widmet sich lange Zeit ihrer Bühnenkarriere. Die älteste Tochter wächst bei ihrer Mutter auf und ihr Mann begleitet Pauline häufig auf ihren Tourneen. Dann beendet sie mit 42 Jahren ihre Bühnenlaufbahn, unterrichtet, komponiert und gibt nur noch wenige Konzerte. Clara Schumann bewundert die Leichtigkeit, mit der Pauline alles umsetzt. So schreibt sie nach der Aufführung von zwei kleinen Operetten von Pauline: «Mit welchem Geschick, feinsinnig, anmuthig, abgerundet das alles gemacht ist, dabei oft amüsantester Humor, das ist doch wunderbar! […] und kaum hat sie das alles aufgeschrieben, spielt es nur so aus Skizzen-Blättern! Und wie hat sie das einstudiert, die Kinder, wie sind sie bezaubernd […]! Überall in der Begleitung hört man die Instrumentation heraus – kurz ich fand wieder bestätigt, was ich immer gesagt, sie ist die genialste Frau, die mir je vorgekommen, und wenn ich sie so sitzen sah am Klavier, das alles mit der grössten Leichtigkeit leitend, so wurde mir weich ums Herz […].»
Fanny Mendelssohn
Fanny Mendelssohn erhält zwar die gleiche musikalische Ausbildung wie ihr Bruder Felix, ihre Situation als Frau verunmöglicht es ihr aber, ihre Kompositionen zu veröffentlichen. So schreibt ihr Vater der fünfzehnjährigen Tochter: «Was du mir über dein musikalisches Treiben im Verhältnis zu Felix in einem deiner früheren Briefe geschrieben, war ebenso wohl gedacht als ausgedrückt. Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll; […]. Beharre in dieser Gesinnung und diesem Betragen, sie sind weiblich, und nur das Weibliche ziert die Frauen.» Auch später ermahnt er sie in diesem Sinne, was Fanny einem Freund gegenüber folgendermassen kommentiert: «Daß man übrigens seine elende Weibsnatur jeden Tag, auf jedem Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekömmt, ist ein Punkt, der einen in Wuth, und somit um die Weiblichkeit bringen könnte, wenn nicht dadurch Übel ärger würde.»
Felix, der andere Komponistinnen wie Josephine Lang und Johanna Kinkel in ihrem Komponieren ermutigt, bleibt Fannys Bemühungen gegenüber ablehnend. So schreibt er an seine Mutter: «Du lobst mir ihre neuen Compositionen, u. das ist wahrhaftig nicht nöthig, […] denn ich weiss ja, von wem sie sind. Auch […] dass ich, sowie sie sich entschliesst, etwas herauszugeben, ihr die Gelegenheit dazu, so viel ich kann, verschaffen und ihr alle Mühe dabei, die sich ihr ersparen lässt, abnehmen werde. Aber zureden etwas zu publicieren kann ich ihr nicht, weil es gegen meine Ansicht und Überzeugung ist. […] ich halte das Publicieren für etwas Ernsthaftes […] und glaube, man soll es nur thun, wenn man als Autor sein Lebenlang auftreten und dastehn will. […] Und zu einer Autorschaft hat Fanny, wie ich sie kenne, weder Lust noch Beruf, dazu ist sie zu sehr eine Frau, wie es recht ist, […].» Als sich Fanny mit vierzig Jahren entschliesst, ihre Kompositionen herauszugeben, im Wissen darum, dass das ihrem Bruder missfällt, erteilt ihr Felix endlich den «Handwerkssegen» und wünscht ihr viel Freude.
Johanna Kinkel
Johanna Kinkel scheint schon sehr früh gewusst zu haben, dass sie Musik «zu ihrem Geschäft machen» will. Die Familie findet das nicht angemessen. Die Grossmutter sagt: Wir «haben es ja, Gott sei Dank nicht nötig, dass unser einziges Kind Musik zu seinem Unterhalte lernen sollte». Darum wird Johanna auf eine Schule geschickt, wo sie das «Haushalten» lernen soll. Das liegt ihr allerdings gar nicht. «Ach wie viel lieber und leichter hätte ich Generalbass gelernt, denn dass ein Ding dieses Namens existierte, welches einem zum Begriff des Komponierens verhelfe, hatte ich schon irgendwo gehört.»
«Ich mag keine Dilettantin sein, ich will Künstlerin werden.» Dieses Ziel strebt sie in der Folge mit grosser Konsequenz an. So reist sie zu Felix Mendelssohn, um ihm vorspielen zu können, und organisiert dann ihre Musikausbildung in Berlin. Nach dem Studium in Generalbass fühlt sie sich befähigt, ihre Ideen umzusetzen. «Ich hatte von Jugend auf den Trieb des Komponierens gefühlt, aber ich wollte ihn nicht dadurch abschwächen, dass ich ohne Kenntnis der Theorie eine Menge dilettantischer Einfälle zu Papier brachte, wie es so oft geschieht. […] Jetzt, wo ich erkannte, was mich ehedem am klaren Hinstellen meiner inneren Melodienwelt gehindert, drängte es in mir, als ob alle meine Gedanken knospen und zu Tönen erblühen wollten.»
Louise Adolpha Le Beau
Glaubt man den Rezensenten der Zeit, komponiert keine der Frauen so «männlich» wie Louise Adolpha Le Beau. «Man erwartet solche Solidität der theoretischen Durchbildung, solche Gewandtheit in der Formenbehandlung, wie in der Orchestrierung, von Damen für gewöhnlich nicht; hier finden wir einen männlich ernsten Geist, einen künstlerischen Ausbau auf äußerst solidem Fundament, verbunden mit feiner Empfindung für Formen- und Klangschönheit,» so ein Lob an Le Beau. Als sie bei Rheinberger in München vorspricht, um Stunden nehmen zu können, lehnt er ab. Er will keine Frauen unterrichten. Nach dem Vorspielen eigener Kompositionen wird sie als «Herr Kollege» akzeptiert, dabei attestiert er ihrer Violin-Sonate op.10 ausserordentliche Qualität, sie sei «männlich, nicht wie von einer Dame komponiert». Dieses Lob zieht sich wie ein roter Faden durch die Rezensionen, so auch in folgendem Kommentar: «Frl. le Beau gehört unter die Ausnahmen, die es weiter bringen; schrieben nicht viele Männer wirklich schlechte Musik, dann würde ich mein Lob in die Worte kleiden: sie komponirt wie ein Mann!» Einerseits sucht Le Beau die Anerkennung als Komponist(in), andererseits gerät sie in Konkurrenz zu ihren männlichen Kollegen. Trotz ihrer Qualitäten sucht sie vergeblich ein Opernhaus, das ihre Oper aufführt, auch eine Professur für Komposition in Berlin bleibt ihr verschlossen. Frauen sind für diese Stelle nicht vorgesehen.
Klavierwerke und Lieder
Wenn man sich die Kompositionen der Frauen aus dem 19. Jahrhundert anschaut, so dominieren ganz eindeutig Klavierwerke und Lieder das Bild. Dies ist so bei Clara Schumann, Johanna Kinkel, Josephine Lang und weitgehend bei Fanny Hensel. Wobei eine Übersicht über die Kompositionen von Fanny Hensel auch heute noch nicht vorhanden ist.
Fanny Hensel beschreibt ihre Schwierigkeit, längere Werke zu schreiben, folgendermassen: «Es ist nicht sowohl die Schreibart, an der es fehlt, als ein gewisses Lebensprinzip, u. diesem Mangel zufolge sterben meine längeren Sachen in ihrer Jugend an Altersschwäche, es fehlt mir die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten, ihnen die nöthige Consistenz zu geben. Daher gelingen mir am besten Lieder, wozu nur allenfalls ein hübscher Einfall ohne viel Kraft der Durchführung gehört […].» Wenn Frauen sich schon in die Komposition vorwagen, dann im Bereich Klaviermusik, Lied und Kammermusik. Die grossen Formen, Oratorium, Oper und Sinfonie gehören zum «männlichen» Komponieren. In diesem Bereich bewegen sich – wenn auch nicht mehrheitlich – Mary Wurm und Louise Adolpha Le Beau.
Sinfonien
Seit Beethoven ist die Sinfonie sozusagen die Krönung der Komponistenkarriere. Mary Wurm schreibt eine Kindersinfonie und Louise Le Beau eine (einzige) Sinfonie (op.41), was ihr bewundernde Rezensionen einbringt: «Es ist wohl das erste Mal, daß eine Dame sich auf den Höhepunkt der Instrumentalmusik empor geschwungen hat, und zwar mit Erfolg. Die Komponistin versteht nicht bloß die sinfonische Form meisterhaft zu behandeln, sondern dieselbe auch durch einen Reichtum musikalischer Gedanken einheitlich zu verbinden.» Und: «Es gehört unzweifelhaft für eine Dame ein großer Muth dazu, eine Symphonie zu schreiben, sowohl wegen der eigenthümlichen Schwierigkeiten dieser Musikgattung wie auch wegen des Vorurtheils, das man im Publikum der Leistung einer Dame auf diesem bisher ausschließlich Männern vorbehaltenen Gebiete der Composition entgegenbringt. Frl. Le Beau durfte den Muth dazu aus dem Reichthum ihrer musikalischen Erfindung, ihrer für eine Dame phänomenalen Compositionstechnik und ihrer sicheren Beherrschung der orchestralen Ausdrucksmittel schöpfen. Ihre Symphonie in F dur ist ein zwar nicht immer gleichwerthiges, aber in allen Sätzen fesselndes und ausgezeichnet durchgearbeitetes Musikwerk…»
So gesehen hat also nur eine der von uns ausgewählten Komponistinnen wirklich den Olymp erreicht. Musikalische Qualität gibt es aber zum Glück auch ohne Götterberg. Diese grossartige, vielseitige Welt der Komponistinnen ist eine Reise wert, es gibt immer noch viel zu entdecken.
Konzert








