Sind Musikwettbewerbe nur gut gemeint?
Am 18. April diskutierten in der Musik-Akademie Basel Georges Starobinski, Sigfried Schibli, Stephan Schmidt und weitere Experten über den Sinn von Musikwettbewerben.
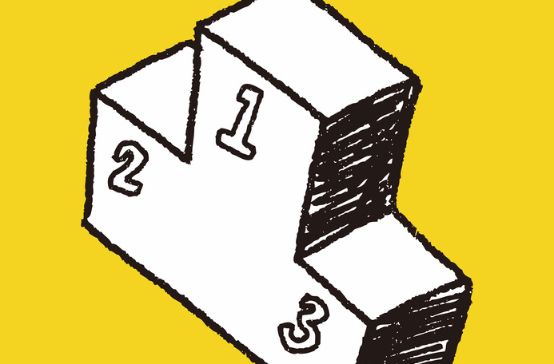
«Können wir uns eine Gesellschaft ohne Musik vorstellen?», fragte Maria Iselin zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Förderpreises der Basler Orchester-Gesellschaft (BOG). «Nein», lautete die klare Antwort der BOG-Stiftungsratspräsidentin. Aber mit einer kleinen Differenzierung in der Fragestellung wird das Antworten schon schwieriger: «Können wir uns eine Gesellschaft ohne gute Musik vorstellen?» Was ist gute Musik? Und wie findet man dafür einen guten – oder gar den besten – Interpreten? Seit Jahrhunderten versuchen Menschen, diese Fragen zu beantworten.
Schon in der Antike gab es Musikwettbewerbe, wie Georges Starobinski, Leiter der Musikhochschule Basel, in seinem Eingangsreferat betonte. Auch die Sängerkriege im Mittelalter, bei denen Dichtermusiker gegeneinander antraten, sind gut belegt. Doch was macht einen Musikwettbewerb heute aus? Ist er gut für die Musiker, gut für das Publikum? Oder – so lautete die Titelfrage des Podiums – «sind Musikwettbewerbe nur gut gemeint?»
Es ist eine selbstkritische Frage, die sich die BOG stellt. Seit zwanzig Jahren verleiht sie alljährlich Anerkennungs- und Förderpreise unter den Studierenden der Musikhochschule Basel. Aus dem kleinen, aber feinen Wettbewerb gingen so namhafte Persönlichkeiten wie die Cellistin Sol Gabetta, der Klarinettist Reto Bieri oder die Sopranistin Svetlana Ignatovich hervor.
Das Preisgeld ist mit insgesamt bis zu 15 000 Franken nicht üppig, doch eine notwendige finanzielle Unterstützung für junge Studierende. Denn – darin waren sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion einig – alle jungen Musiker, die an Wettbewerben teilnehmen, wollen vor allem eines: gute Musik machen. Dafür brauchen sie Raum und Zeit, und natürlich Geld, um keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen zu müssen.
Ein weiterer bedeutender Faktor ist die Vernetzung in der internationalen Musikszene. Bei den meisten grossen Wettbewerben zahlt sich ein Sieg durch nachfolgende Konzertengagements aus. Manchmal automatisch, manchmal nur mit tüchtiger Eigeninitiative. Auch dies ist für den einzelnen Musiker ein positiver und erwünschter Nebeneffekt. Aber ist es das auch für das Publikum?
Gift für die Individualität
Sigfried Schibli, Podiumsteilnehmer und Musikkritiker bei der Basler Zeitung, resümierte, dass in den letzten 40 Jahren die Uniformität im Musikleben zugenommen habe: «Wirklich originelle Künstler erlebt man heute seltener.» Er ist der Überzeugung: «Wettbewerbe sind Filterinstrumente für Nervenkraft und Technik – und ein Symbol dafür, dass wir alle konkurrieren. Es gibt ja heute Wettbewerbe für jede Sparte, selbst für Journalisten.»
Dass Musikwettbewerbe Kreativität nicht fördern können, ist für Stephan Schmidt, Gitarrist und Direktor der Musikhochschulen der Fachhochschule Nordwestschweiz, klar: «Wettbewerbe beziehen sich auf einen Standard. Man vergleicht etwas, das man schon kennt.» Dennoch schliessen sich Wettbewerbe und Kreativität nicht aus: Oftmals sind es die Träger der zweiten und dritten Preise grosser Wettbewerbe, die schliesslich Karriere machen – sie haben es geschafft, technisches Können und Individualität zu vereinen.
Ob ein Wettbewerb einem jungen Musiker eher schade oder eher nutze, hänge von seiner eigenen Einstellung ab, ist Schmidt überzeugt: «Es geht immer darum, sich selbst weiterzuentwickeln.» Ganz verschiedenes Repertoire intensiv für einen Wettbewerb zu üben, kann die persönliche Entwicklung sehr fördern. Für ihn selbst seien damals Wettbewerbe die einzige Möglichkeit gewesen, aus seiner dörflich geprägten Heimat hinaus in die Welt zu ziehen. Auch der Pianist Carl Wolf, BOG-Preisträger von 2004, zieht aus seiner Wettbewerbszeit die Bilanz: «Man nimmt immer etwas mit: Man lernt neue Säle kennen, neue Leute, neues Repertoire, sammelt viele Erfahrungen.»
Ob Musikwettbewerbe nicht nur die Preisträger, sondern alle Teilnehmenden fördern, hängt wesentlich vom ehrlichen Feedback der Jury ab. Doch genau da hapert es meist, wie alle Musiker auf dem Podium zu berichten wussten. Vielleicht, weil es auch für erfahrene Juroren gar nicht möglich ist, auch nach der zehnten Wiedergabe des gleichen Stücks Unterschiede zu erkennen, wie der Geiger Volker Biesenbender einst in einem Artikel in der Basler Zeitung zugab. Vielleicht aber auch, weil es zu viele Interessenskonflikte zwischen Lehrern und Schülern, Kollegen und Seilschaften gibt.
Das abschliessende Konzert mit Preisträgern aus 20 Jahren BOG-Förderpreis liess jedoch alle Wettbewerbskritik vergessen. Ein grosser Reichtum an Musikalität, Kreativität und Persönlichkeit zeigte sich da – und wie herrlich, einmal ein so bunt gemischtes Konzertprogramm, das mit seinen kurzen Stücken eher an einen Hochschulanlass denken liess, auf allerhöchstem Niveau zu erleben. Da gab es eine Uraufführung von Maximiliano Amicis Kammermusikstück Ithaca mit der geschmeidigen Sopranistin Amelia Scicolone, eine furiose Beethoven-Sonate mit Sol Gabetta, faszinierend poetisch-sprechende Schumann-Fantasiestücke mit der Klarinettistin Karin Dornbusch, eine fulminante, wilde Reise durch Schumanns Carnaval mit dem Pianisten Paavali Jumppanen. Wenn Wettbewerbe – und seien es so kleine wie derjenige der BOG – solche Musiker hervorbringen, dann ist auch einiges richtig daran.








