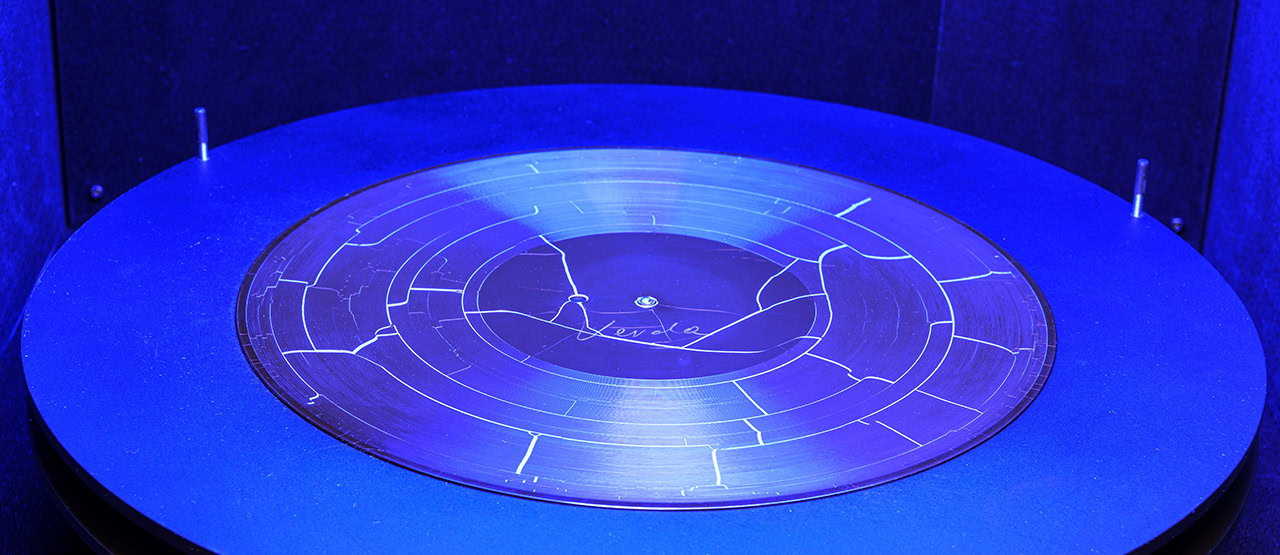Variationen über ein Schweizer Lied
Jeden Freitag gibts Beethoven: Zu seinem 250. Geburtstag blicken wir wöchentlich auf eines seiner Werke. Heute auf die Sechs Variationen über ein Schweizer Lied für Klavier oder Harfe.

«Noch ein Wort von Volksliedern. Sie sind wahrlich das, worauf der wahre Künstler, der die Irrwege seiner Kunst zu ahnden anfängt, wie der Seemann auf den Polarstern achtet, und woher er am meisten für seinen Gewinn beobachtet. Nur solche Melodien, wie das Schweizerlied, sind wahre ursprüngliche Volksmelodien, und die regen und rühren auch gleich die ganze fühlende Welt, das sind wahre Orpheusgesänge.» Vielleicht war es ein Zufall, dass Beethoven um das Jahr 1790 noch in Bonn auf diese Worte von Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) aufmerksam wurde – abgedruckt im Vorwort der kleinen Sammlung Frohe Lieder für Deutsche Männer (1781) und ergänzt um eine elf Takte umfassende Melodie mit folgender Textunterlegung: «Es hätt’ e’ Buur e’ Töchterli, mit Name heißt es Babeli, sie hätt’ e paar Zöpfli, sie sind wie Gold, drum ist ihm auch der Dusle sic! hold.» Angesichts dieser nur der Spur nach verständlichen Wiedergabe des Schwyzerdütsch darf man wohl froh sein, dass uns in dieser Quelle die übrigen zehn Strophen der Weise erspart bleiben. Das Lied um Babeli und Dursli jedenfalls erzählt, wie so viele Volksgesänge, die Geschichte einer tragischen Liebe, die am Ende den jungen Mann in den Söldnerdienst treibt.
Dies alles blieb Beethoven verborgen. Zur künstlerischen Ausarbeitung könnte er daher allein durch den unregelmässigen Aufbau (3+3+2+3 Takte) und das archaisch anmutende Melos angeregt worden sein. Zunächst ergänzte er die Melodie um eine einfache Basslinie, anschliessend setzte er sechs einfach realisierbare Variationen hinzu. Das Werk ist noch heute im Klavierunterricht präsent. Seltsam mutet allerdings die Besetzungsangabe der 1798 bei Simrock in Bonn erschienenen Erstausgabe an: «Clavecin, ou Harpe». Während der Hinweis auf das Cembalo noch durchaus üblich war (der Erneuerungsprozess hin zum aufkommenden Hammerklavier vollzog sich allmählich), verblüfft die Erwähnung einer Harfe als Alternative. Einen Hinweis zur Aufklärung gibt Beethoven selbst 1796 in einem Brief an den Klavierbauer Johann Andreas Streicher (1761–1833). Nachdem er die junge Augsburgerin Elisabeth von Kissow (1784–1868) auf einem Hammerflügel spielen gehört hatte, schrieb er: «es ist gewiß, die Art das Klawier zu spielen, ist noch die unkultiwirteste von allen Instrumenten bisher, man glaubt oft nur eine Harfe zu hören, und ich freue mich lieber, daß sie von den wenigen sind, die einsehen und fühlen, daß man auf dem Klawier auch singen könne, sobald man nur fühlen kann, ich hoffe die Zeit wird kommen, wo die Harfe und das Klawier zwei ganz verschiedene Instrumente seyn werden.» Die vom Verlag eingefügte Besetzungsangabe scheint also einer zu diesem Zeitpunkt noch durchaus verbreiteten Aufführungspraxis zu entsprechen.
Hören Sie rein!