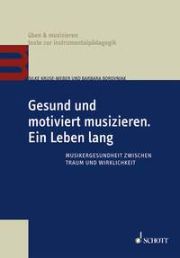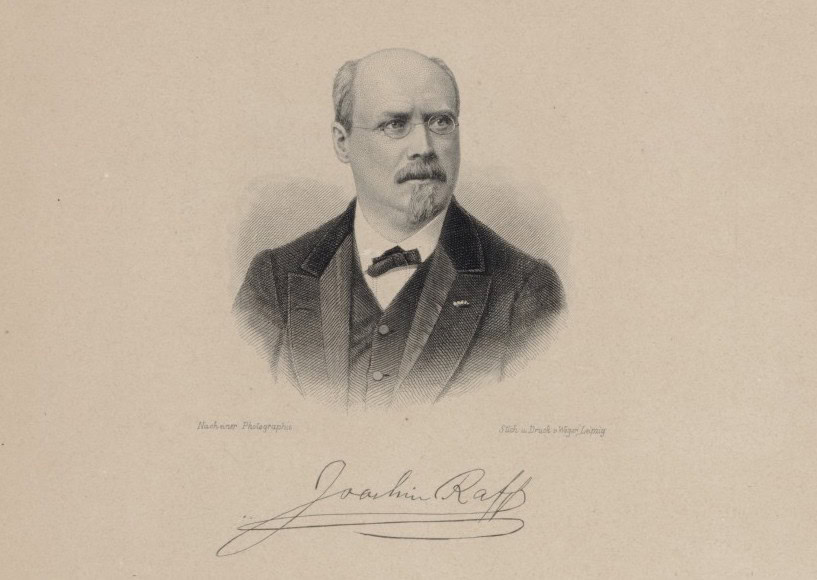Nicht mehr «durchwursteln»
Musikergesundheit ist in den letzten Jahren ein wichtiges Thema geworden. Dieses Buch fasst die Beiträge eines interdisziplinären Symposiums zusammen.

Als ich vor 40 Jahren von Milan Škampa persönlich, dem Bratscher des weltberühmten Smetana-Quartetts, erfuhr, dass er vor jedem Konzert Antidepressiva einnehmen müsse, und dies schon seit 20 Jahren, war ich zutiefst erschrocken. Dann erfuhr ich noch von Hörstürzen bei Musikern bei uns in der Schweiz, die bis zur teilweisen Berufsaufgabe führten – und kaum eine Institution, die sich für solche Berufskrankheiten einsetzte, selbst die SUVA bot damals noch kaum Hilfe. Heute haben die Musikausbildungsstätten die Problemfelder erkannt und bieten direkte Hilfestellung und Kurse an, eine reichhaltige Literatur liegt bereit, um das Bewusstsein für Gefährdungen bei der intensiven Musikausübung zu erweitern.
Das könnte man jedenfalls meinen: In den informativen Schlussbetrachtungen dieses Buches muss man aber feststellen, dass vieles an den Musikhochschulen erst im Entstehen begriffen ist, dass die Bemühungen um den Schulterschluss von Musikphysiologie und Musikermedizin von persönlichen Initiativen ausgehen, welche erst Netzwerke aufzubauen versuchen. Einzelne Hochschulen, worunter auch Zürich und Basel, scheinen in manchen Bereichen an der Spitze der Entwicklung beteiligt zu sein.
Alle Beiträge dieses Buches sind Resultate eines interdisziplinären Symposiums 2013 in Graz, das sowohl das Musizieren von Laien als auch von Profis berücksichtigte. Übe-Techniken, Umgang mit dem «Lampenfieber», Probleme der Haltung, die Befreiung von starren Regeln und viele weitere Problemfelder kommen zur Sprache. Dass einige Beiträge durch wissenschaftlichen Jargon belastet sind, muss nicht erstaunen, da grundlegend neue Erkenntnisse sprachlich benannt und systematisiert werden mussten, um sich dem interdisziplinären Diskurs öffnen zu können. Nur am Rande wird der Vergleich zum Spitzensport gezogen, denn «ebenso wie Sportler bewegen sich Musiker nicht selten an den Grenzen der individuellen sensomotorischen und biomechanischen Möglichkeiten». Die «gesamtkonditionelle Beanspruchung beim Instrumentalspiel und beim Gesang wird im Allgemeinen deutlich unterschätzt. Das Herz-Kreislauf-System zeigt während des Musizierens ausgesprochen ‹sportliche› Reaktionen, … weshalb eine gute körperliche Kondition von grosser Bedeutung ist».
Junge Leute mit dem Ziel eines Musikberufes werden nicht mehr ganz ahnungslos in diese Problemzonen hineintappen, Musikschaffende mittleren Alters könnten aber eschreckt feststellen, in wie vielen Situationen sie sich irgendwie selbst «durchgewurstelt» haben.
Dieser Sammelband Üben & Musizieren – Texte zur Instrumentalpädagogik bietet vielseitige Orientierung über den Stand der Forschung, über alle möglichen Gefährdungen, aber auch Anregungen zur Selbstkontrolle und Selbsthilfe. Das aufgezeichnete Gespräch am runden Tisch zur aktuellen Situation legt allerdings offen, dass man vielerorts noch weit davon entfernt ist, genügend fachgerechte Beratung anbieten zu können.
Gesund und motiviert musizieren. Ein Leben lang. Musikergesundheit zwischen Traum und Wirklichkeit, hg. von Barbara Borovnjak und Silke Kruse-Weber, 297 S., € 16.95, Schott, Mainz 2015, ISBN 978-3-7957-0867-2