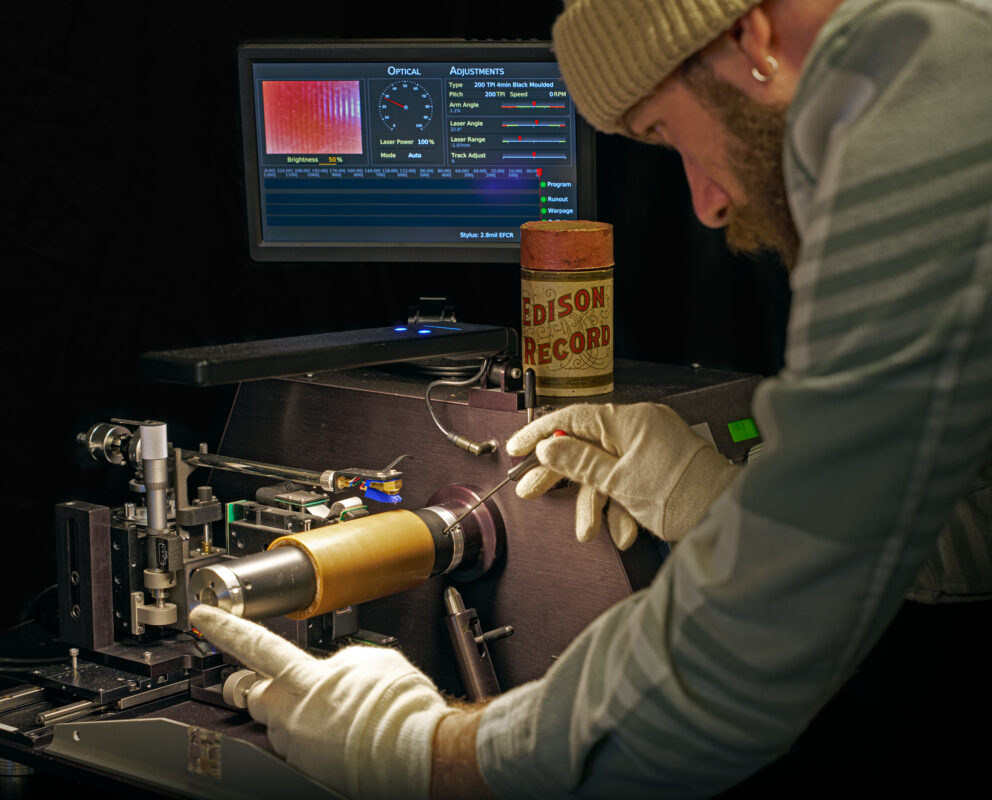Von elektroakustischer Musik zu Sound Arts
Elektroakustische Musik in der Hochschulausbildung in der Schweiz.
Weiter ging es in den 1950er Jahren mit einer prominent besetzten Tagung zum Thema elektronische und konkrete Musik in Basel, gefolgt vom Weltmusikfest der IGNM in Zürich zum gleichen Thema. Internationales Aufsehen erregte das Experimentalstudio von Herrmann Scherchen im Tessiner Gravesano mit der Zeitschrift «Gravesaner Blätter» sowie einer UNESCO Tagung zu elektronischer Musik. Der Jazzmusiker und Schweizer Pionier der elektronischen Musik, Bruno Spoerri, ist da bereits aktiv und experimentiert mit frühen elektronischen Instrumenten und bald auch mit ersten Computern. Er gründet 1985, noch bevor die im Umbruch befindlichen Schweizer Musikhochschulen das Themenfeld für sich entdecken, die für die weitere Entwicklung wichtige unabhängige «Schweizer Gesellschaft für Computermusik».
Zwei Jahre später erfolgt mit der Gründung des Elektronischen Studios der Musikakademie der Stadt Basel unter der Leitung des Schweizer Komponisten Thomas Kessler die erste Etablierung eines Studiengangs unter dem Dach einer Musikhochschule. Nun bestand auch in der Schweiz die Möglichkeit, elektroakustische Musik mit Tonbandmaschinen, Synthesizern und professioneller Studiotechnik zu studieren.
Angesichts der technologischen und ästhetischen Popularisierung elektronischer Künste gründen alle Schweizer Musikhochschulen Ende der 1990er Jahre entsprechende Studiengänge mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Allen gemeinsam ist die Öffnung der bis dahin eher akademischen elektroakustischen Musik in verschiedene Richtungen. Zunehmend werden die Fluxus Bewegung und Videokunst ebenso als Vorläufer für die elektronischen Künste begriffen wie Sound Arts, Performance Arts und Medienkunst, die internationale Szene hat diese Entwicklung vorbereitet: Bildende Künstler wie Bill Fontana können mit der neuen technologischen Materialität von Sound erstmals «plastisch» arbeiten, während Architekten wie Bernhard Leitner mit Räumen aus Klang experimentieren. Künstler*innen wie Alvin Lucier, Max Neuhaus, Nam June Paik, Christina Kubisch und Laurie Anderson finden neue Zugänge zum Sound über den öffentlichen Raum, die Skulptur oder die Performance. Diese Phänomene bewegen sich abseits der traditionellen kompositorischen Strategien bzw. der elektroakustischen Künste wie Tonbandkompositionen, Computermusik oder algorithmische Komposition.
«Audiodesign» nennt sich der Studiengang am elektronischen Studio der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. An der 2002 in Bern gegründeten ersten Hochschule der Künste der Schweiz heisst dieser Studiengang zunächst «Musik und Medienkunst»; er wird 2018 in «Sound Arts» umbenannt. Die «Schweizer Gesellschaft für Computermusik» geht 2005 im «Institute für Computermusic and Soundtechnology» (ICST) auf, welches Teil der 2007 gegründeten Zürcher Hochschule der Künste wird.
Allen gemeinsam ist, dass Themenfelder wie Filmvertonung, Klanginstallationen, Field Recordings, Szenografie, Game Sound und Hardware Hacking ebenso wie elektronische Gehörbildung, Live-Elektronik, verschiedene Programmiersprachen und experimentelle Ansätze in der Pop- und Clubmusik ihren festen Platz in den Curricula finden. So wundert es nicht, dass Transdisziplinarität für viele Jahre zum bestimmenden Diskursfeld aller Hochschulen wird. Wie können die verschiedenen Künste – auch unter dem Aspekt ihrer universellen Repräsentation in den digitalen Medien – sinnvoll geöffnet und verknüpft werden?
Dies stellt in der Konsequenz einen historisch angestammten Kanon an Themen, Technologien und Ästhetiken zunehmend und radikal in Frage. Angesichts der universell verfügbaren digitalen Hard- wie Software ist nach dem Stellenwert und der Ausbildung in traditioneller Musiktheorie, Musikgeschichte und Gehörbildung zu fragen.
Schliesslich stellt die Entwicklung generativer KIs und ihrer weiter zunehmenden Möglichkeiten in Bezug auf Komposition, Sounddesign und Simulationen neue Herausforderungen dar. Damit sind wir in einer ähnlichen Situation wie in den 1950er Jahren, als die damals neuen Möglichkeiten der Elektronik grundsätzliche Weichenstellungen erforderten. Allerdings befinden sich die Schweizer Musikhochschulen nun in einer wesentlich besseren Ausgangslage. Ich hoffe sie nehmen die Herausforderung an.