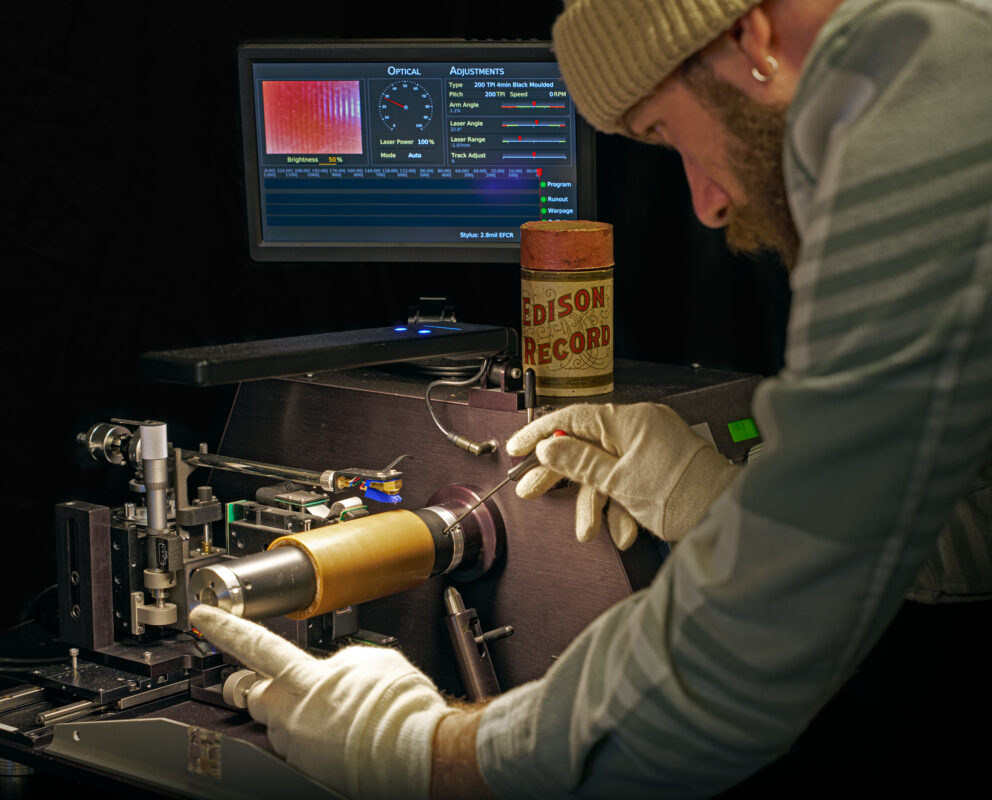Tagung: Professionelle Musikausbildung
Am 23. und 24. Juni 2025 findet an der Zürcher Hochschule der Künste eine Tagung mit Referaten und Zeitzeugenberichten zur Vorgeschichte des Departements Musik von 1873 bis heute statt.
Seit über 150 Jahren existierte im Kanton Zürich eine erstaunliche Vielfalt an Schulen für angehende Berufsmusiker und -musikerinnen. Heute sind diese alle in das Departement Musik der ZHdK eingegangen. Besonders die Zeit um die Jahrtausendwende war geprägt von Fusionen, Integrationen und Neuorganisationen. Auf das Zusammengehen von Konservatorium Zürich und Musikakademie Zürich folgte die Fusion mit dem Konservatorium Winterthur, die Integration der Schauspiel- und der Tanzakademie, die Verbindung mit dem Rhythmikseminar, den Ausbildungen in Schul- und Kirchenmusik und schliesslich die Grossfusion mit der Hochschule für Gestaltung und Kunst zur heutigen ZHdK. Noch heute sind die unterschiedlichen Herkünfte und Geschichten der Teilinstitutionen zu spüren. Aber eine genaue Aufarbeitung der institutionellen Wandlungen und der Kräfte von aussen und innen, die auf diese Veränderungen einwirkten, steht noch aus. Darum hat das Institute for Music Research der ZHdK begonnen, die Akten und Protokolle, die Jahresberichte und Hauszeitungen zu sichten. Dabei hat sich gezeigt, dass bislang nicht einmal die Namen aller Studierenden und Dozierenden seit den Gründungen der verschiedenen Schulen bekannt sind.
Denn bis im Jahre 1944 existierten im Kanton Zürich vier Institutionen, an denen professionelle Musikerinnen und Musiker ausgebildet wurden: die Musikschule Winterthur (ab 1952 auch Konservatorium; gegründet 1873), das Konservatorium Zürich (gegründet 1876), die Musikakademie Zürich (gegründet 1891) sowie das Privatkonservatorium José Berr (1913–1944). Es gibt also genügend Stoff, um die Unterschiede in den Entwicklungen jener Schulen aufzuzeigen, welche in das heutige Departement Musik eingegangen sind.
Bei der Durchsicht der schriftlichen Dokumente ist aber auch klar geworden, dass darin die wichtigsten Revolutionen häufig gar nicht genau benannt sind, weil sie damals allen Beteiligten nur allzu vertraut waren.
Aus diesem Grund besteht unsere Tagung nicht bloss aus Vorträgen, welche historische Fakten zu einzelnen Teilschulen resümieren, sondern auch aus offenen Gesprächen mit damaligen Zeitzeugen; denn die bisherige Arbeit hat gezeigt, dass persönliche Konstellationen, temporäre Schlagworte und politisches Kalkül hinter den damaligen Entscheidungen standen, welche ihrerseits die Atmosphären innerhalb der betreffenden Schulen bestimmt haben. Dabei haben auch die Bologna-Reform und die Verpflichtung der Fachhochschulen zur Forschung die genannten Prozesse zeitlich und inhaltlich begleitet. Letztlich münden diese Rückblicke in die Frage, wie sich vor dem Hintergrund der institutionellen Wandlungen die musikalische Ausbildung der Studierenden verändert hat und ob die Errungenschaften von damals nicht auch Rückschritte mit sich gebracht haben.
Darum richtet sich die Einladung zur Teilnahme an dieser Tagung an alle, die sich für Fragen der professionellen Musikausbildung interessieren, selbst – innerhalb des Kantons Zürich oder ausserhalb – als Studierende oder Lehrende an jenen Veränderungen teilgenommen haben und heute darüber reflektieren möchten. Das Forschungsprojekt «Professionelle Musikausbildung im Kanton Zürich» wird die Ergebnisse in die weitere Aufarbeitung einbeziehen und setzt sich zum Ziel, die Besonderheiten der zürcherischen Entwicklungen in den grösseren Kontext der Musikausbildung in Europa zu stellen. Denn was wäre eine Musikforschung, wenn sie nicht die biografischen, pädagogischen und institutionellen Grundlagen einbezieht, auf denen doch jede Musikerin und jeder Musiker und damit letztlich das ganze Musikleben basiert?