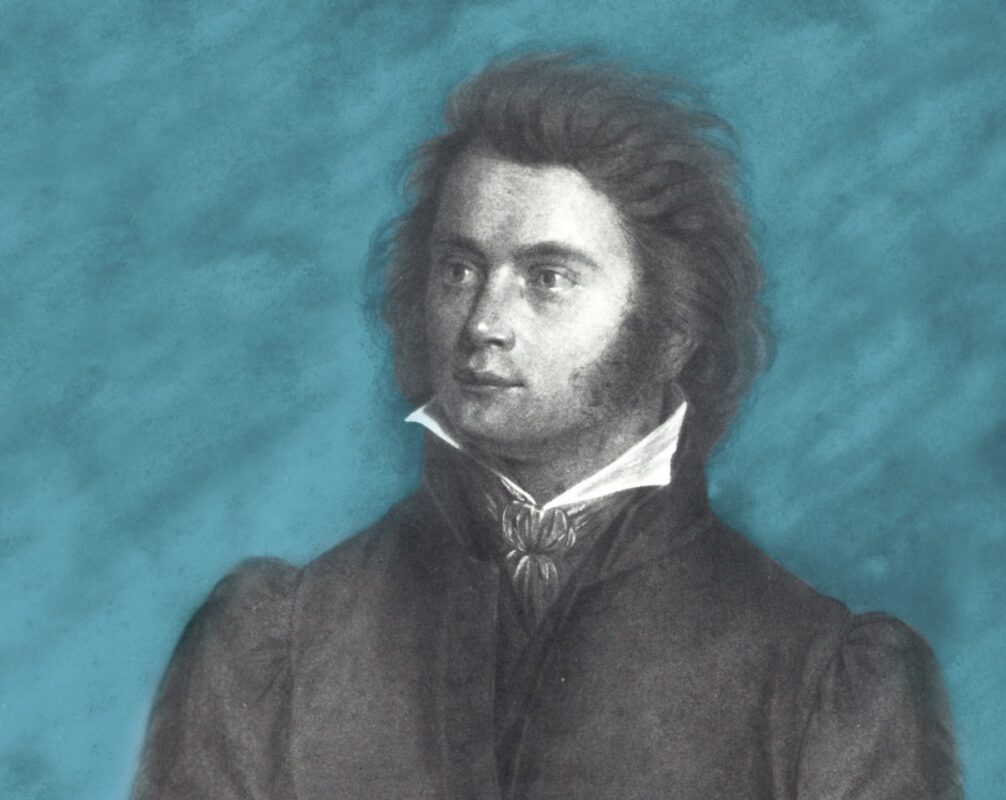«The Groovy Drumbeat»: Forschung im Musikunterricht
Ein Team der Hochschule Luzern zog mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds los, um Jugendlichen Forschung rund um den Groove nahezubringen. Ein Erfahrungsbericht.

Die Themen der Musikforschung sind so vielseitig wie die Materie selbst und die gewonnenen Erkenntnisse mehren sich nicht monatlich oder wöchentlich, sondern täglich. Schaut man sich aber einmal an, wie viele dieser Erkenntnisse tatsächlich in einem breiteren öffentlichen Diskurs landen, wird es doch schnell sehr mager.
Ich gehöre einem Forschungsteam der Hochschule Luzern – Musik (HSLU) an, das sich unter der Leitung von Olivier Senn der Ergründung des «Groove» widmet, einem Phänomen aus der Wahrnehmungspsychologie. Groove erleben wir, wenn wir beim Musikhören den Drang verspüren, uns zur Musik zu bewegen, und dies von positiven Emotionen begleitet ist. Ein völlig alltägliches Phänomen, fast alle kennen es.
Allein in Psychology of Music und Music Perception (zwei wichtige Zeitschriften, die auf die Wahrnehmung von Musik spezialisiert sind, was auch die Groove-Forschung umfasst), wurden im Jahr 2024 über 100 Artikel veröffentlicht. Jetzt kann sich jeder selbst die Frage stellen, mit wie vielen dieser Studien er im Alltag in Berührung gekommen ist. Wäre ich nicht im Wissenschaftsbetrieb tätig, würde ich diese Frage wohl mit «gar keiner» beantworten. Forschungserkenntnisse erreichen uns fast ausschliesslich dann, wenn sie so spektakulär sind, dass sie im Wissenschaftsteil einer grossen Tageszeitung landen.
Dies liegt auch daran, dass die Verbreitung von Ergebnissen an eine breite Öffentlichkeit im Forschungsprozess eher stiefmütterlich behandelt wird. Geforscht wird zumeist an Hochschulen oder Universitäten. Für die Projekte müssen Drittmittel akquiriert werden und die Budgets sind dadurch oft knapp. Viele Projekte sind mit der Veröffentlichung ihrer Studie im Wissenschaftsjournal beendet, selten bleiben Mittel für die Vermittlung an die Allgemeinheit.
Der Nationalfonds springt ein
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) ist sich dieser Problematik bewusst und hat das Agora-Programm eingerichtet mit dem Ziel, «Kommunikationsprojekte zu fördern, die einen direkten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ermöglichen».
Wir waren der Ansicht, dass unser Forschungsfeld «Groove» besonders für Jugendliche einen sehr niederschwelligen Einstieg in wissenschaftliches Arbeiten bietet: Musik ist allgegenwärtig. Sie beeinflusst unser Bewegungsverhalten und unsere Emotionen. Die allermeisten Menschen erleben es regelmässig, wenn sie sich beim Musikhören bewegen wollen und die Stimmung mitunter stark positiv beeinflusst wird. Man muss diese Materie nicht erst schmackhaft machen. Wir reichten beim Nationalfonds ein Gesuch ein und bekamen für unser Projekt «The Groovy Drumbeat» Unterstützung zugesprochen.
Die Idee war, unsere Forschung in Workshops an die Schulen in den Musikunterricht zu bringen. Dabei wollten wir nicht nur Vorträge halten, sondern die Klassen aktiv einbeziehen. Insgesamt konnten wir die Workshops an 6 Schulen in 4 Kantonen mit 17 Klassen und knapp 230 Schülerinnen und Schülern (SuS) durchführen. Sie waren zwischen 14 und 18 Jahre alt. Manche waren in Neigungsklassen mit einem Fokus auf Musik, andere besuchten den regulären Musikunterricht.
Mehr Aufwand als gedacht
Bei der Ausarbeitung der Workshops mit den Kollegen Toni Bechtold, Lorenz Kilchenmann und Rafael Jerjen mussten wir schnell feststellen, dass es zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel sind, im Labor zu forschen oder diese Forschung für Laien verständlich aufzuarbeiten, ohne dabei wesentliche Punkte wegzulassen. Wir benötigten viel mehr Zeit für die Vorbereitungen, als im Vorfeld erwartet. Das hatten wir gehörig unterschätzt.
Die Workshops, bestehend aus zwei Sessions, wurden in aufeinanderfolgenden Wochen während je einer Doppellektion von 90 Minuten durchgeführt. Zum Einstieg hörten wir gemeinsam Musik, versuchten mittels Bodypercussion Groove zu erzeugen und diskutierten, in welchen Situationen die SuS in ihrem Alltag Groove erleben. Dann leiteten wir Fragen ab, wie man dieses Phänomen wissenschaftlich untersuchen könnte. In unseren Forschungsprojekten führen wir zu diesem Zweck meist Hörexperimente durch, in denen kurze Hörbeispiele (Stimuli) hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Menschen untersucht werden. Drumbeats, wie wir sie aus der Popularmusik kennen, dienen uns dabei häufig als Audio-Stimuli.

Ein solches Experiment wollten wir mit den Klassen aufgleisen und durchführen. Dabei war es uns ein Anliegen, dass die SuS ihre eigenen Hörbeispiele (Stimuli) dafür komponierten. Wir fanden eine geeignete Onlinesoftware «Groove Scribe», mit der sich ohne grosse Vorkenntnisse nach kurzer Einführung Beats «bauen» lassen. Die SuS sollten je einen groovigen und einen ungroovigen Drumbeat komponieren. Diese Stiumuli luden wir auf die Onlineplattform SoSci Survey in unsere Experimentvorlage. Die Teilnahme am Experiment war als Hausaufgabe zu erledigen und in der darauffolgenden Woche ging es für uns zurück in die Schulen, um mit den Klassen die Ergebnisse zu diskutieren und zu überlegen, wie sich diese im Höralltag der SuS widerspiegeln.
Niederschwelliges Thema – hohes Reflexionsniveau
Sehr erfreulich war für uns das hohe Niveau, auf dem die SuS reflektierten und diskutierten. Natürlich variierten Vokabular und Ausdruck je nach Alter, dennoch war es kein Problem für die Jugendlichen, ihre eigenen Beobachtungen zu beschreiben und zu verstehen, wie unsere Groove-Untersuchungen funktionieren und was die Probleme dabei sind.
Ein schönes Beispiel dafür: Bei allen Experimenten mit allen Klassen kam heraus, dass es zwar Stimuli gab, die als sehr ungroovig empfunden wurden, jedoch die groovigsten Patterns es maximal bis ins obere Mittelfeld schafften. Es gab also keine, die als sehr groovig empfunden wurden.
Auf die Frage, woran das liegen könnte, kam bei ausnahmslos allen Klassen als erste Antwort, dass es sich ja gar nicht um «ganze Musik» handle, sondern nur um die Drumbeats. Damit erkannten die SuS sofort eine der grössten Einschränkungen, bei dieser Art von Forschung, nämlich dass wir, um das Experiment kontrollieren zu können, sehr oft keine vollständige Musik verwenden können, sondern die Stimuli reduzieren müssen.

Beim «Bauen» der Beats wurde ebenfalls schnell klar, dass die SuS sehr genau wissen, welche Art von Beats sie zum Tanzen bringen und wie diese beschaffen sein müssen. Wir demonstrierten zuvor einige Aspekte, wie Dichte, Regelmässigkeit, Instrumentierungen etc. und los ging es. Egal ob Neigungsklassen oder allgemeiner Musikunterricht, die Hörexperimente zeigten durchwegs, dass die Beats, die mit dem Ziel komponiert wurden, «groovig» zu sein, auch meist so bewertet wurden und umgekehrt.
Erkenntnisse für das persönliche Hören
In der zweiten Doppellektion des Workshops ging es vor allem darum, das Hörexperiment zu interpretieren, also sich mit der Frage zu beschäftigen, warum ein Beat groovt und ein anderer nicht. Auch hier wussten die SuS genau, warum ein Beat für sie groovt oder nicht. In aller Regel war die Transparenz des Pulses sehr wichtig. Aber auch die Dichte an Klangereignissen im Pattern oder eine ungewöhnliche Instrumentierung (z. B. Cymbals oder sonstige Perkussion), die die Beats interessanter machten, spielten eine Rolle.

Die beiden Top Drumbeats jeder Klasse versuchten wir zusätzlich mit Bodypercussion und sonstigen Perkussionsinstrumenten umzusetzen. Hier zeigten sich dann doch grosse Unterschiede: Mit den Neigungsklassen war grundsätzlich mehr möglich, was jedoch nicht nur den unterschiedlichen Interessen, sondern auch der Gruppengrösse zuzuschreiben war. Die Neigungsklassen waren sehr klein.
Um die Workshops abzuschliessen, war es uns wichtig, die gewonnenen Erkenntnisse auf die Musik zu übertragen, die die Jugendlichen auch tatsächlich in ihrem Alltag hören. Wir hörten zusammen von den SUS ausgewählte Musik und wurden Zeugen teils lebhafter Debatten darüber, welche Musik nun groovig ist und welche nicht.
Impulse werden aufgenommen und weiterentwickelt
Mit diesem Projekt betraten wir als Team Neuland. Obwohl wir alle in irgendeiner Form unterrichten, sei es als Instrumentallehrer oder in einzelnen Kursen an der Hochschule, hatten wir noch nichts Vergleichbares gemacht. Dies betraf viele Bereiche, von altersgerechter Aufarbeitung der Thematik bis hin zur Auseinandersetzung mit den Dynamiken in Schulklassen von Jugendlichen. Der Wissenstransfer lief hier nicht auf einer Einbahnstrasse und auch die Lehrpersonen, die die Workshops natürlich begleiteten, teilten uns mit, sehr profitiert zu haben, und baten uns um noch mehr Material zu solchen Themen. Es stehen auch schon Ideen im Raum, im Rahmen von Projektwochen vielleicht einmal ein ganzes Panel zu organisieren, während dem die Jugendlichen eigene kleine Forschungsarbeiten durchführen und selbst Vorträge halten könnten. Auch gemeinsames Musizieren und kleine Konzerte wären möglich. Was daraus wird, wird die Zukunft zeigen.