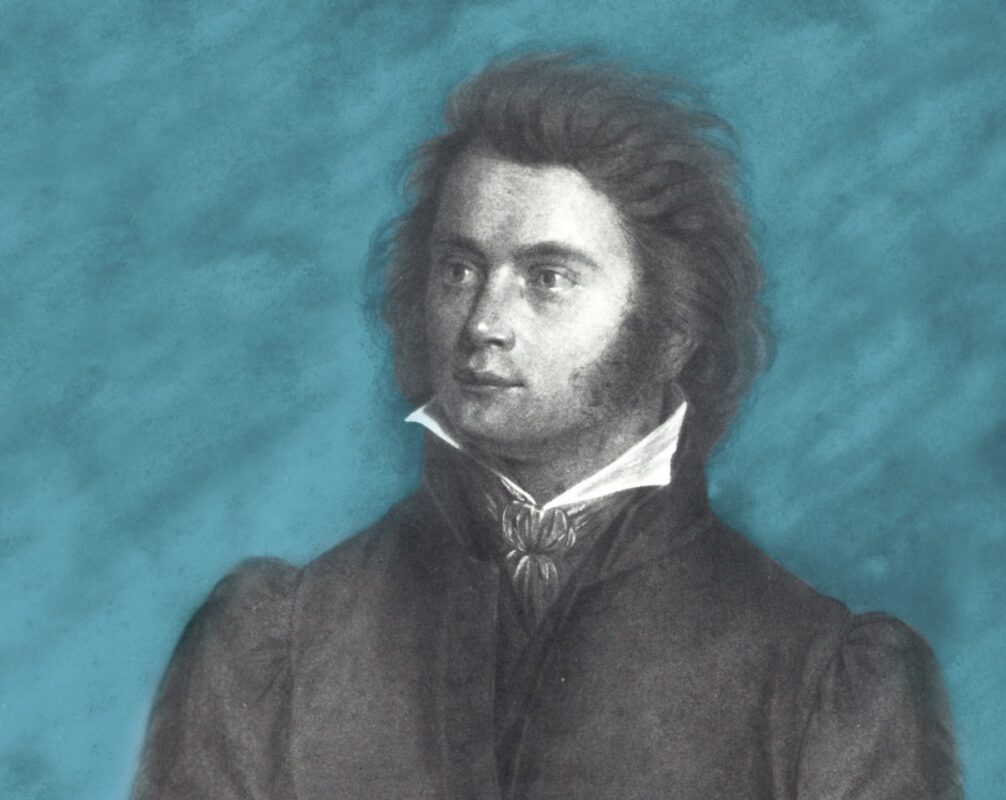Wenn Jugendliche die Zukunft komponieren
Das Young Composers Project am Künstlerhaus Boswil ist eine Initiative mit Vorbildcharakter.

Wie kann ich Komponieren lernen? Wie bringe ich meine Musik vom Kopf aufs Papier? Wie entwickle ich einen musikalischen Gedanken? Diese Grundfragen standen im Zentrum des Young Composers Project (YCP), das seit März an einem Wochenende pro Monat im Künstlerhaus Boswil stattfand und elf jungen Komponierenden aus der Deutschschweiz die Gelegenheit bot, unter der Anleitung hochkarätiger Lehrpersonen eigene Werke zu erarbeiten. Der Jüngste war neun, der Älteste neunzehn Jahre alt. Die Ergebnisse des aussergewöhnlich erfolgreichen Projekts werden am 7. September in Boswil und am 9. September in der Kantonsschule Wettingen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Begabtenförderung im Bereich des Instrumentalspiels wird heute vielerorts praktiziert. Beim Komponieren hingegen herrscht oft die Meinung vor, das sei eine Angelegenheit für Erwachsene, den Kindern und Jugendlichen fehlten dafür die nötigen Fähigkeiten. Das Gegenteil ist wahr. Davon konnte man sich überzeugen bei einem Besuch des YCP an einem Juniwochenende in Boswil und bei der ersten Probe mit professionellen Musikerinnen und Musikern in Arlesheim im August. Die Vielfalt und Originalität der Ideen, ihre Ausarbeitung und Notation, die meist am Computer geschah, der vorurteilslose Umgang mit Harmonik, der von atonal bis D-Dur reichte, die wache Auseinandersetzung mit theoretischen und praktischen Fragen des Komponierens und das teils noch suchende, teils schon gründlich reflektierte Sprechen über das eigene Tun – das alles weckte Erstaunen und machte neugierig auf die beiden öffentlichen Konzerte im September.
Die Young Composers und ihre Werke
Der Jüngste, der neunjährige Daniel Smirnov, den seine Eltern stets mit dem Auto nach Boswil gefahren haben, hat eine Fantasie komponiert, ein frisch zupackendes, durch Tempo- und Tonartwechsel in kontrastierende Abschnitte unterteiltes Stück für vier Spieler. Er komponiert mit grosser Leichtigkeit, auf seinem Computer hat er über hundert lustige Schweinchenstücke gespeichert, inspiriert durch Walt Disneys Drei kleinen Schweinchen.

Am anderen Ende der Altersskala steht Luca Blanke (*2005), der sich mit The Blind Guitarist für Violine, Cello, Klarinette, Djembe und Triangel ein Bild aus Picassos Blauer Periode zur Vorlage genommen hat. Er versetzt sich in die Lage des blinden Musikanten und übersetzt seine Gedanken auf überlegte Weise in eine mehrschichtige, facettenreich erzählende musikalische Struktur.
Jaël Maier (*2008) spielt Bratsche und hat das Trio Weite im Sturm für Violine, Cello und Klavier komponiert. Weit gespannte Melodien werden darin von bewegten Begleitfiguren untermalt, eine verhaltene innere Erregung prägt das Stück.
Karina Verich (*2009), eine ausgezeichnete Pianistin, die seit ihrer Kindheit Jazz spielt und vor einigen Jahren aus der Ukraine in die Schweiz gekommen ist, hat mit dem Duo As-tu fatigue? für Klavier und Cello pizzicato eine herausfordernde Jazznummer im 7/8-Takt geschrieben. Die beiden Instrumente sind mit kleinteiligen Motiven eng ineinander verhakt, rhythmischer Drive verbindet sich mit schwereloser Eleganz.
In Untitled des gleichaltrigen Laurin Rogausch spielt das Tasteninstrument die Hauptrolle. Der technisch anspruchsvolle Part ist eingebettet in eine Begleitung aus Violine, Cello und Klarinette. Mit den raumgreifenden Läufen und Arpeggien des Klaviers besitzt das in einer erweiterten Durtonalität geschriebene Stück einen ausgeprägt konzertanten Charakter.
Auffällig an der Komposition von Marco Buser (*2006) für fünf Instrumente sind die polyfonen Ansätze in der Stimmführung und der Umgang mit charakteristischen Ausdrucks- und Formtypen. Das detailgenau ausgearbeitete Stück besteht aus drei kontrastierenden Abschnitten – der mittlere basiert auf einem Tangorhythmus – und endet in einem fetzigen Finale. Der Versuch, die divergierenden Teile formal unter einen Hut zu bringen, wird im verspielten Arbeitstitel angesprochen: Rotundum quadrare opportet (etwa: Das Runde muss eckig gemacht werden). Assoziationen an den Fussballerspruch «Das Runde muss ins Eckige» lässt der Komponist übrigens gelten.
Caner Öztas (*2008), der sich schon gut in der akustischen Physik auskennt und die Obertonstruktur eines Instrumentaltons mit lupenreiner Klarheit erläutern kann, kombiniert in The Evolution elektronisch erzeugte Klänge mit Violine, Cello, Klavier und Xylofon. Die auf H basierten, sich fortlaufend wandelnden Lautsprecherklänge verschmelzen mit dem Spiel der Instrumente. Durch das hartnäckige Festhalten am Grundton wird man in das sich verdichtende Klanggeschehen gleichsam hineingesogen.

Der gleichaltrige Loïs Poller entwirft in Vestige für Klarinette, Violine, Cello und Xylofon das Szenario der Suche eines kleinen Jungen nach seinem Vater, was in einer allgemeinen Katastrophe endet. In der expressiven, die Ausdruckswerte sorgfältig gewichtenden Komposition wechseln sich schnelle und langsame Teile ab, doch ein ernster Tonfall ist allen gemeinsam.
Auch Roland Potluka (*2007) fühlt sich eher zu abgedunkelten Gefühlsregionen hingezogen. Im Trio Asphodelus Rêverie bezieht er sich auf die Blume Affodill, die, wie er sagt, mit Trauer in Verbindung gebracht wird. Das inspirierte ihn zu einer interessanten Konstruktion von Wiederholungsstrukturen, in denen sich Cello und Klarinette als führende Instrumente abwechseln, der emotionale Gehalt wird in strukturelle Werte umgesetzt.
Schliesslich Yannick (*2011) und Inès (*2008) Köllner: Die beiden Geschwister erarbeiteten unter dem Titel Nano Haiku eine rund zwanzigminütige Videoinstallation mit Musik, eine schwindelerregende Reise durch eine andere Wirklichkeit, Yannick als bereits versierter, musikalisch denkender Videokünstler und Soundtechniker, Inès als Komponistin und hochbegabte Cellistin, die beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb 2024 mit Lutosławskis kniffliger Sacher Variation brilliert hat. Bei Nano Haiku, wo gesprochene Texte, Musik und Videoprojektion sekundengenau ineinandergreifen, ist sie nun auch als Textautorin und Dirigentin aktiv.

Eine Akademie für den Nachwuchs
Der Zweck dieses Kurses lautete: Ausarbeitung von individuellen Werken bis zur Konzertreife. Dass das nur über eine genaue Notation geht, war selbstverständliche Voraussetzung. Der Kompositionsunterricht im engeren Sinn wurde dabei ergänzt durch ein breites Angebot an Zusatzfächern. Darin ging es um grundsätzliche Aspekte des Komponierens wie Konzeption eines Werks, Notationsform, Instrumentenkunde, Fragen der Formbildung und anderes mehr; auch massstabsetzende Werke der Vergangenheit wurden diskutiert. Das machte aus dem YCP eine veritable Akademie für den Nachwuchs. Mit ihren Lerninhalten und der professionellen Betreuung würde sie jeder Musik(hoch)schule zur Zierde gereichen. Auch für die Boswiler Stiftung, die sich über den hohen Stellenwert des Unternehmens offenbar nicht so richtig im Klaren war, bildet sie einen ungeplanten Glanzpunkt im Rahmen ihres Förderprogramms.
Zu verdanken ist der Erfolg des Projekts einer engagierten Gruppe von Dozierenden, allen voran dem Bariton Robert Koller, der das komplexe Unternehmen quasi im Alleingang organisierte, und der Komponistin Bettina Skrzypczak; sie war 2013 Mitbegründerin und danach langjährige Leiterin des YCP. In diesem Jahr führte sie es im Team mit Robert Koller. Schwerpunktmässig waren ausserdem beteiligt: Lukas Langlotz als musikalischer Leiter der Proben, der Dirigent Cristoforo Spagnuolo als «Special guest», Pierre Funck für Filmmusik und Karin Wetzel, die die Kursteilnehmer mitbetreute.
Und der Cellist Moritz Müllenbach. Am Beispiel der mit Doppelgriffen und Flageoletts gespickten Cellostimme aus der Komposition von Inès Köllner demonstrierte er gemeinsam mit ihr die unerschöpflichen Möglichkeiten der Klangerzeugung auf den Streichinstrumenten, so lustvoll wie ein Spitzenkoch, der seine besten Rezepte verrät. Müllenbach war neben Heidy Huwiler (Klarinette), Friedemann A. Treiber (Violine/Viola), Elizaveta Parfentyeva (Klavier) und Junko Rusche (Schlagzeug) auch Teil des fünfköpfigen Ensembles, das die kompositorischen Erstlinge einstudierte. Mit einer Sorgfalt, als stammten sie von arrivierten Komponisten.
Die öffentliche Probe mit dem Ensemble in Arlesheim war ein erster Probelauf drei Wochen vor den Schlusskonzerten. Hier hörten die jungen Komponierenden ihre Stücke, mit denen sie sich meist nur am Computer beschäftigt hatten, zum ersten Mal live mit Instrumenten. Dabei konnten Unstimmigkeiten der Partitur mit dem Ensemble besprochen und anschliessend korrigiert werden. Und schon hier wurde klar: Die Werke sind der klingende Beweis, dass Kreativität und kompositorische Intelligenz sich im jungen Alter auf ebenso ernst zu nehmende Weise artikulieren können wie bei akademisch Ausgebildeten. Diese verfügen zwar über ein professionelles Handwerk, mehr kompositorische Erfahrung und damit eine reifere Sicht auf die Musik. Das Kapital der Jungen hingegen sind spontane Entdeckerfreude, der Wille, Neues zu lernen und eine ungetrübte Lust am künstlerischen Schaffen. Mit anderen Worten: Im Komponieren unternimmt hier eine neue Generation die ersten Schritte zur Gestaltung der Zukunft.