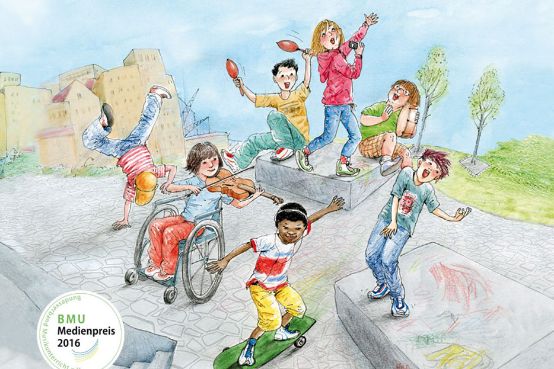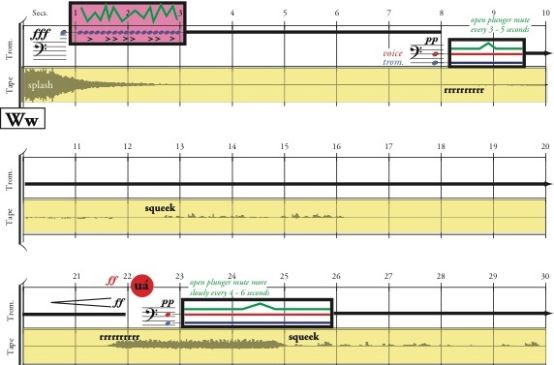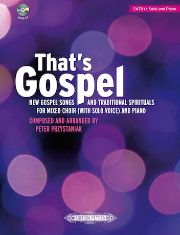Wir sehen Räderwerke, die in rostigen Rahmen hängen. Die grossen Räder greifen ineinander und assoziieren verrückte überdimensionierte Uhrwerke, Fantasiemaschinen, rätselhafte mechanische Apparate. Zerbrochene Musikinstrumente und Klangkörper sind den Maschinenkonstruktionen eingearbeitet. Symbole aus dem Fundus der Kunstgeschichte neben Industrie- und Alltagsgegenständen in überraschenden Funktionen, Glasschüsseln, Ölfässer, Jauchelöffel und Schlackehammer komplettieren die Kolossalskulpturen. Trotz des Rostes und der zahlreichen Spuren von Vergänglichkeit überwiegen bunte, fröhliche Farben. Im Ruhezustand und auf den ersten Blick ähneln sich die vier Musikmaschinen, doch ihr Klangbild ist völlig unterschiedlich. Ein Knopfdruck erweckt sie zum Leben, und dann entfalten sie für ein paar Minuten ihre ganze Individualität.
Méta-Harmonie I ist die melodischste, Geige und Tasteninstrumente sind zentrale Elemente. Verborgen im Getriebe dreht sich ein Gartenzwerg mit Akkordeon wie besessen um seine eigene Achse. Kinderspielzeug ist sehr präsent, eine Pinocchio-Figur aus Holz gleitet über die Tasten eines zerstörten Klaviers. Der Versuch, die Abfolge der Klänge den mechanischen Bewegungen und den dabei entstehenden Bildern zuzuordnen, braucht einige Geduld. Doch, da klingen Tasteninstrumente, eine Tonleiter bildet die Melodie für dumpfe Schläge und Rasseln. Zuhören, erkennen und versuchen, die Mechanismen zu verstehen, oder sich staunend dem Assoziationsfluss überlassen, beide Zugänge haben ihren Reiz.
Das opulenteste Stück der Schau ist die Méta-Harmonie 3 aus dem Jahr 1984, auch Pandämonium No. 1 genannt. Tierschädel, die mit den Kiefern klappern. Ein alter Plastikhase und eine Adlerplastik drehen sich um ihre eigene Achse, zweiundfünfzig Motoren bewegen Räder, deren imaginäre Achsen kreuz und quer durch den Raum verlaufen. Immer neue Details werden sichtbar, wenn die Aufmerksamkeit von den Klängen gelenkt wird. Die ganze Maschine ist geschmückt mit bunten Federbüscheln. Schaubuden-Lichteffekte lassen die Maschine blinken und strahlen, und man spürt, dass Tinguelys Auseinandersetzung mit dem Tod nicht tragisch oder beängstigend, sondern ein barockes Sinnenfest ist, das seinen Bezug zum Basler Totentanz nicht verleugnet.
Tinguelys Synthese der Künste
Méta-Harmonie ist ein herausforderndes Wort. Annja Müller-Alsbach, Kuratorin der Ausstellung, erklärt es so: Die Töne, die Jean Tinguely mit seinen Maschinen erzeugt, das Schrillen und Krächzen, Rattern und Poltern, sind das Gegenteil von Harmonie. Seine Skulpturen sind keine Musikmaschinen im eigentlichen Sinn, sondern Klangmischmaschinen. Von Anfang an verwendete Jean Tinguely Töne als künstlerisches Material. Häufig greift er vorgefundene Alltags- und Industrieklänge auf, die er wie seine plastischen Objekte als Fundstücke behandelt. Der akustische Reiz, der von den Skulpturen ausgeht, soll den visuellen Reiz komplettieren. Hören und Sehen sind für das Verständnis seiner Arbeiten gleichbedeutend.
Er sah seine Méta-Harmonien als eigenständige Erscheinungen, wenn auch Bezüge zur minimalistischen Neuen Musik oder zur Fluxus-Bewegung, zu John Cage und Robert Rauschenberg erkennbar sind. Jean Tinguely ging es jedoch nicht um einen Beitrag zur Musik seiner Zeit, sondern um eine Synthese der Künste.
Der Solo-Auftritt jeder einzelnen Méta-Harmonie ist ein Erlebnis, das Staunen und Heiterkeit auslöst. Aber man sollte sich auf keinen Fall die Gelegenheit entgehen lassen, die vier Méta-Harmonien und die fahrbare Skulptur Klamauk, die die Serie ergänzt, in Interaktion zu erleben. Dann geschieht etwas Unerwartetes: Es stellt sich tatsächlich Harmonie ein. Die Töne und Geräusche der fünf Skulpturen greifen ineinander, ergänzen sich oder heben einander auf, und es entstehen Klangbilder, die Melodien und Rhythmen ausbilden. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Arbeiten im Verlauf von acht Jahren entstanden sind und gleich an ihre Auftraggeber ausgeliefert wurden, so dass Jean Tinguely selbst nie die Gelegenheit hatte, sie im Dialog zu erleben. Das Zusammenspiel der Musikmaschinen ist in der Ausstellung mehrmals am Tag jeweils zur halben Stunde mitzuverfolgen.
Museumsdirektor Roland Wetzel betonte in seiner Eröffnungsrede die Einmaligkeit des Ereignisses: Unwahrscheinlich, dass die Grossplastiken in absehbarer Zeit wieder zusammenkommen werden. Zwei befinden sich in der Sammlung in Basel, eine in Wien, und Méta-Harmonie 3 aus Karuizawa, Japan, war acht Wochen als Seefracht unterwegs, ehe sie ihren Platz im Ausstellungsraum einnehmen konnte.