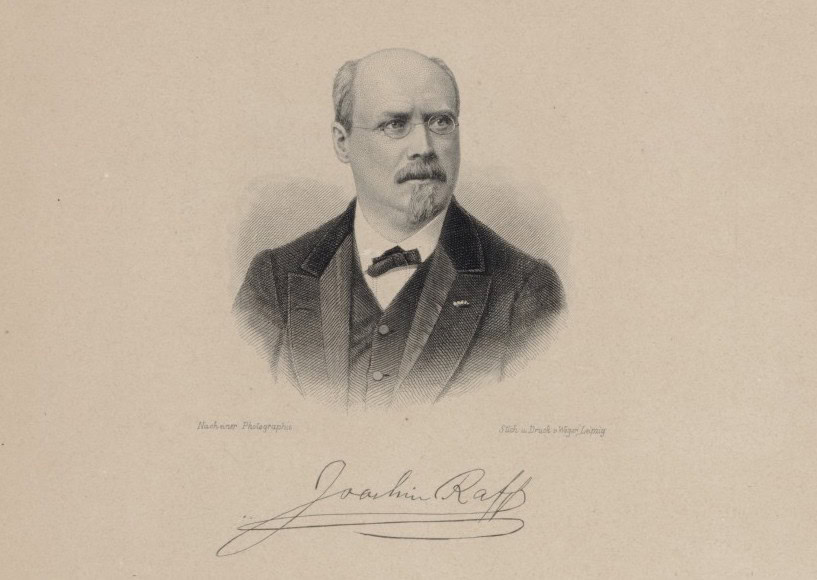Kritik oder Quote
Fritz Trümpi und Simon Obert haben einen Band zum Thema «Musikkritik» herausgegeben.

Hier der Zeitdruck, dort das Werk, schliesslich die Redaktion, die schon mal ein Wörtchen mitredet, wenn es um die Veröffentlichung geht: Musikkritik scheint ein Vabanquespiel. Erschwert durch jene aktuellen Zwänge, die der Musikredaktor Christian Berzins in seiner Glosse pointiert zum Ausdruck bringt: «Wenn eine Kritik nicht populär – d. h. für alle verständlich – geschrieben ist, hat sie in der zukünftigen Tageszeitung nichts mehr verloren» (S. 173/174).
Wer «alle» sind oder was «verständlich» heisst, bleibt offen. Muss wohl offen bleiben in einem Sammelband, der nicht alles leisten, den Blick aber weiten kann für ein komplexes Phänomen, das sich stark gewandelt hat seit den Anfängen der Musikkritik im späten 18. Jahrhundert. Der von den Musikwissenschaftlern Fritz Trümpi und Simon Obert herausgegebene Band blickt zurück, aber auch in die Gegenwart. Katherine Baber berichtet in ihrem englischen Aufsatz über die Rezeption Leonard Bernsteins in Amerika und Österreich (S. 33 f.). Sie zeigt: Musikkritik spiegelt nicht nur Werke oder Interpretationen. Sie ist immer auch ein Reflex diverser Themen, die weit über das Künstlerische hinausreichen. Der kalte Krieg, Antisemitismus, auch die Konstruktion nationaler Identitäten spielten eine grosse Rolle bei der Aufnahme Bernsteins, dessen Popularität dadurch stieg, dass er in den 1960er-Jahren als so etwas wie ein zweiter Gustav Mahler inszeniert werden konnte.
Die Vielfalt des Bandes beeindruckt. Popkritik fehlt ebenso wenig wie Gedanken über journalistische Praxis oder über publizistische Zugangsmöglichkeiten zur Neuen Musik. Leider erzwungen wirken Cornelia Bartschs deutungsfreudige Reflexionen über Musikkritik und Gender. «Ein Desiderat» (S. 59) ist die Thematik deshalb, weil Frauen – analog zu ihrer Rolle im 19. Jahrhundert – in der Kritik einfach nichts zu suchen hatten. Da Kritikerinnen nicht auftauchen, versucht es Bartsch mit abenteuerlichen Thesen. Sie vermengt geschlechterspezifische Bewertungen von Musik im Sinne von weiblich versus männlich munter mit jenen Erscheinungen, die die Vermarktungsindustrie und das unsägliche Quotendenken in die «Kritik» hineintragen: «Bewertung» von Musik nach puren Äusserlichkeiten wie Starkult oder Sexappeal jeweiliger Interpreten oder Interpretinnen.
Nicht nur Spuren von Geschichte und Gegenwart sind ablesbar, sondern auch die Perspektiven der Musikkritik. Die Tage des «Grosskritikers» scheinen gezählt – jener Spezies, die das Konzert lesend verfolgen und sich später ereifern über die mangelhafte Gestaltung der Eroica-Reprise. Das muss nicht schlimm sein, bemerkt Berzins zu Recht. Was jedoch zu denken gibt, ist die Verflachung, ja das Verschwinden von Inhalten. Es wäre schön, wenn sich Kritik dagegen stellen könnte – in welcher Form, ist am Ende auch eine Frage des Standes musikalischer Bildung. Kollegen ist übrigens passiert, dass in der Redaktion «Partitur» durch «Notenbild» ersetzt wurde. Da ist dann halt Hopfen und Malz verloren.
Musikkritik. Historische Zugänge und systematische Perspektiven, hg. von Fritz Trümpi und Simon Obert, (=Anklänge, Wiener Jahrbuch für Musikwissenschaft 2015), 204 S., € 33.00, Mille Tre Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-900198-42-8