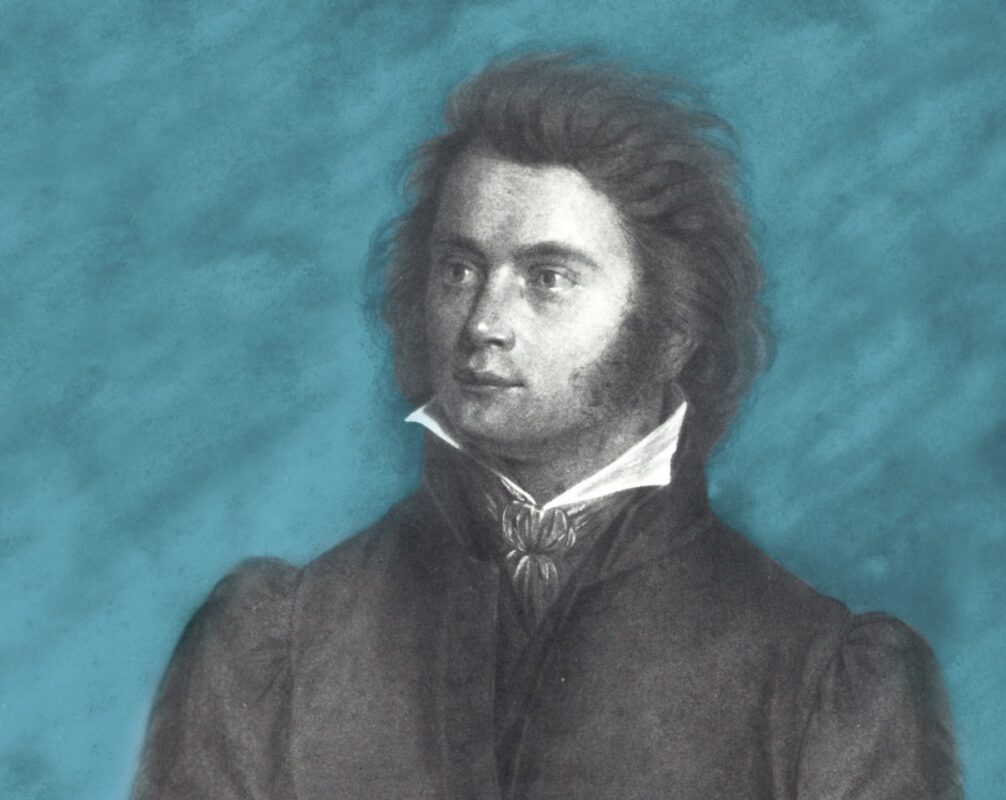Forum Musik und Alter
Musikalisches Lernen im Alter hat eigene Gesetze, die in der Forschung bereits gut beschrieben sind. An einer wissenschaftlichen Veranstaltung an der Hochschule der Künste Bern (HKB) wurden Grundzüge aufgezeigt.

Das Forum «Perspektiven musikalischen Lernens und Lehrens im Alter» am 29. März in Bern war die Auftaktveranstaltung für den an der HKB angebotenen CAS «Musikalisches Lernen im Alter», der im Herbst 2014 in die zweite Runde geht. In der Dichte der vermittelten Informationen hatte dieser Crashkurs selbst schon einen hohen Weiterbildungswert.
Neueren Forschungen gemäss ist eine neuronale Plastizität bis ins hohe Alter gegeben. Mit Gehirnscannern kann dies heute zweifelsfrei bewiesen werden. Das lange geltende Vorurteil, wonach ältere Menschen nichts Neues mehr lernen könnten, ist somit nachhaltig entkräftet. Das gilt besonders auch für das Erlernen eines Instrumentes. Die Nachfrage im Unterrichtssegment 50plus steigt und demografische Daten legen die Vermutung nahe, dass es sich dabei um einen Wachstumsmarkt handeln dürfte – Gründe genug, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen.
Es ist nie zu spät
«Lebenslanges Lernen ist möglich», das betonten die beiden Gastgeberinnen Regula Stibi, Leiterin der Abteilung Weiterbildung an der HKB, und Corinne Holtz, Studiengangsleiterin CAS «Musikalisches Lernen im Alter». Sie durften eine interessierte und engagierte Teilnehmerschar sowie vier Gäste begrüssen.
Eckhart Altenmüller, Professor für Musikphysiologe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, erklärte die Wirkung von Musik auf das Gehirn und belegte diese mit Bildern von gescannten Gehirnen. Fängt der Mensch an zu musizieren, findet ziemlich bald eine Neuvernetzung von bisher nicht verbundenen Hirnregionen statt und die Nervenstränge vergrössern sich.
Die Stimulation des Hörzentrums bei musikalischen Tätigkeiten hat erwiesenermassen positive Auswirkungen auf die emotionale und soziale Kompetenz, den Spracherwerb und die kognitiven Prozesse. Das gilt auch für die älteren und hochaltrigen Menschen. Zudem wird dem regelmässigen Musizieren eine heilende oder präventive Wirkung zugesprochen: Musikmachen ermöglicht unter anderem den Aufbau einer «kognitiven Reserve», die eine eventuelle Demenzerkrankung signifikant hinausschieben kann. Das Gehirn schrumpft zwar im Alter, doch bewahrt es die Fähigkeit, sich durch Neuvernetzungen anzupassen, verloren gegangene Fähigkeiten zu kompensieren und neue Strategien zu finden. Das kommt vor allem bei komplexen Berufen wie bei Lehrern, Therapeuten, Musikern und Ärzten zum Tragen.
Eigenwillige Alte – offener Unterricht
Reinhild Spiekermann, Professorin für Allgemeine Instrumentalpädagogik, Klavierdidaktik/Methodik an der Hochschule für Musik Detmold gilt als erste Adresse für Musikgeragogik, die Musikpädagogik für alte Menschen. Die Referentin bezeichnete die «biografischen Determinanten» des älteren Lernenden als zentral. Die Motivation, sich für Musikunterricht zu entscheiden ist von Mensch zu Mensch höchst unterschiedlich. Manche hatten schlechte Erfahrungen mit Lernprozessen, haben Erfolge, Misserfolge, biografische Brüche und Rückschläge erlebt und vergleichen meist die neuen Erfahrungen mit den früheren. Dieses rückbezügliche System beeinflusst Lernmuster und Selbsteinschätzung. Hier heisst es für die Lehrperson, in dialogischer Form an die lebensgeschichtlichen Erfahrungen des Lernenden anzuknüpfen. Ermöglichungsdidaktik ist gefragt und keine Erziehungsdidaktik.
Körperliche Einschränkungen des Sehens, Hörens und der Motorik müssen selbstverständlich mit einbezogen werden. Auch auf die Gedächtnisleistung muss Rücksicht genommen werden. Der alte Mensch lernt oft auf Umwegen, kann eigensinnig sein und lässt sich ungern belehren. Wenige, aber klare Anweisungen sind besser als zu viel auf einmal. Neues Material gilt es behutsam einzuführen. Klare Lektionsabläufe, ergonomische Hilfen und passende, eventuell vereinfachte Literatur sind von Vorteil. Das Thema «Fortschritt» müsse differenziert aufgefasst werden. Spiekermann empfiehlt mehrere Stücke ähnlichen Schwierigkeitsgrades nach einander zu erarbeiten. «Auf diese Art wird oft schon genug Bewegung ins Lernen gebracht. Ein Fortschritt wird eher durch das Feilen an Details erreicht als durch die Steigerung des Schwierigkeitsgrades».
Wissenschaftliche Angebote fehlen
An der Schlussrunde nahm Hanspeter Schenk, Schulleiter der Musikschule Oberemmental, auf dem Podium Platz. Er berichtete von einem steigenden Interesse an Instrumental- und Gesangsunterricht im Segment 50plus an seiner Schule. Schenk sieht im Erwachsenenunterricht auch eine Chance für Lehrpersonen mit sinkenden Pensen. Man kann Pensenverluste kompensieren und vermehrt Vormittage für den Unterricht nutzen.
Corinne Holtz vermisst in der Schweiz pädagogisch-didaktische Konzepte für den Bereich Musik und Alter. In der Schweiz gebe es noch keine institutionalisierte wissenschaftliche Wissensvermittlung zum Thema. Neben dem CAS laufen an der HKB noch andere Projekte zum Thema Musik und Alter. Im Rahmen des Programms «Musikpanorama» (www.musikpanorama.ch) fand Ende April ein Workshop mit Corinne Holtz unter dem Titel «Kontrabass lernen mit 58» statt. Die Hochschule wirkt ausserdem an einem Forschungsprojekt zum Thema «Lern- und Lehrstrategien im Instrumentalunterricht 50plus» in Kooperation mit der Berner Fachhochschule Wirtschaft, Gesundheit, Soziale Arbeit mit. Drei Gruppen, 50plus, Hochaltrige und Lehrende werden zu verschiedenen Punkten interviewt. Dieses Projekt läuft Sommer 2015. Im Anschluss daran soll eine Online-Plattform mit einem Leitfaden zum Thema entstehen. Das wäre weltweit das erste Hilfsmittel dieser Art.