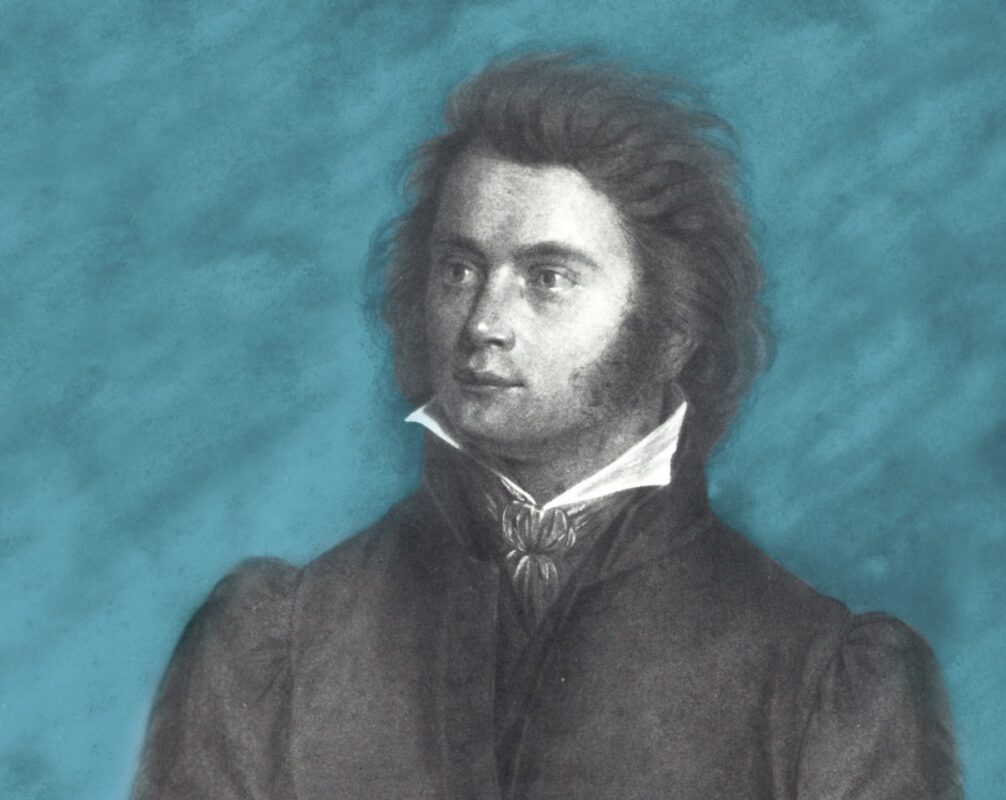Von Zensur, Aufbegehren und Tod
Mitte September fand im Basler Stadtcasino «Macht Musik – Ein Festival über die Freiheit der Kunst in Diktaturen» statt. Es bot aufschlussreiche Einblicke in das Musikleben in der Sowjetunion.

Musik in Diktaturen ist ein fast unerschöpfliches Gebiet. Das Basler Festival zu diesem Thema legte seinen Fokus auf die Sowjetunion. Es wurden Werke von Dmitri Schostakowitsch und Sergei Prokofjew, den beiden bekanntesten sowjetischen Komponisten, gespielt, aber auch von Komponisten (keinen Komponistinnen), denen man hierzulande nie im Konzert begegnet.
Zu Beginn ein Höhepunkt mit Schostakowitsch
Dass man das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) für ein Konzert nach Basel holen konnte, war ein absoluter Glücksfall. Unter der Leitung von Vladimir Jurowski, einem hervorragenden Dirigenten, der die Musik plastisch zur Geltung bringt, spielte es im ersten Teil Werke mit aktuellen politischen Bezügen zur jeweiligen Entstehungszeit. Lidice von Bohuslav Martinů ist eine erschütternde Hommage an das von den Nazis dem Erdboden gleichgemachte Dorf in Tschechien; mit der Meditation über den altböhmischen Choral St. Wenzeslaus wollte Josef Suk die Bemühungen zur Gründung eines tschechoslowakischen Staates unterstützen; Arnold Schönberg schrieb die Ode to Napoleon Buonaparte 1942 im amerikanischen Exil und vertonte dabei eine Schmährede von Lord Byron auf Napoleon mit offensichtlichen Bezügen zur damals aktuellen Situation.
Nach der Pause hörte man die monumentale, über einstündige 11. Sinfonie von Schostakowitsch. Sie wurde äusserst engagiert und diszipliniert gespielt. 1957 uraufgeführt, unterlief diese Sinfonie die Erwartungen des Regimes auf ein bedeutendes Stück zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution, indem der Komponist den Aufstand von 1905 in St. Petersburg thematisierte, wo der Zar auf eine hungernde, unbewaffnete Menge hatte schiessen lassen.
Es braucht nicht viel Fantasie, um das Werk als ein mahnendes Gedenken an alle gewaltsam niedergeschlagenen Versuche des Aufbegehrens, wie etwa den ungarischen Aufstand 1956, zu sehen. Äusserlich erfüllte der Komponist zwar die Normen des «sozialistischen Realismus», durch die Zitate – die von der Obrigkeit nicht erkannt wurden – kann die Sinfonie aber durchaus als regimekritisch verstanden werden. In der Schilderung des Massakers geht Schostakowitsch bis an die Grenzen dessen, was die Ohren von Konzertbesucherinnen und -besuchern und die Akustik eines Konzertsaals ertragen können; das geht unter die Haut. Dieses Konzert war ein erster, lange nachhallender Höhepunkt des Festivals.
Am folgenden Abend spielten das in Basel bestens bekannte Belcea Quartet und die exzellente Pianistin Yulianna Avdeeva die bekannten Klavierquintette von Schostakowitsch und Mieczysław Weinberg.
Ukrainische Komponisten in sowjetischer Zeit
Die drei Werke ukrainischer Komponisten im Konzert mit dem Kyiv Symphony Orchestra unter der Leitung von Oksana Lyniv waren vielleicht nicht über alle Zweifel erhaben. In seiner Simplizität fesselte das Tripelkonzert des heute in den Niederlanden lebenden Maxim Shalygin (geb. 1985) am wenigsten. Berührend ist hingegen das Schicksal von Vasyl Barvinsky (1888–1963): Auf behördliche Anweisung musste er der Zerstörung seiner Manuskripte zustimmen, verbrachte 10 Jahre im Gulag und versuchte in den verbleibenden Lebensjahren, seine Werke zu rekonstruieren. Seine Ukrainische Rhapsodie ist ein relativ leichtgewichtiges Stück in der Nachfolge von Dvořák und Smetana. Die Heroische Symphonie von Yevhen Stankovych, einem heute 83-jährigen Komponisten, der auch unter Zensur zu leiden hatte, ist als Ganzes kein absolut befriedigendes Werk, enthält aber bemerkenswert instrumentierte Passagen.
Trübe Gedanken statt Regimekonformität
Nach einer brillanten Interpretation von Sergei Prokofjews 6. Klaviersonate (1939/40) spielte der hervorragende ukrainische Pianist Alexey Botvinov das 3. Klavierkonzert Ave Maria (1968) von Alemdar Karamanov (1934–2007) in seiner eigenen Bearbeitung für Soloklavier: ein von starker Religiosität geprägtes Werk, das das Publikum durch seine Expressivität in den Bann schlägt, obwohl es mit zu seiner Entstehungszeit sehr altmodischen Mitteln komponiert wurde.
Sehr wichtig im Festivalkontext war die Aufführung von Schostakowitschs 14. Sinfonie op.135 für Sopran, Bass und Kammerorchester aus dem Jahr 1969. Dieses seinem Freund Benjamin Britten gewidmete Werk kreist in Vertonungen von Gedichten von García Lorca, Apollinaire, Küchelbecker und Rilke um den Tod in seinen ganz verschiedenen Erscheinungen. Der Komponist, inspiriert von seiner Instrumentation von Mussorgskis Liedern und Tänzen des Todes, bemühte sich hier gar nicht mehr, Musik zu komponieren, die mit den Idealen des Sowjetstaates kompatibel war, sondern verlieh trüben Gedanken an Unfreiheit, Resignation und Tod Ausdruck. Der von Heinz Holliger geleiteten Aufführung mit Evelina Dobračeva (Sopran), Michael Nagy (Bariton) und dem Kammerorchester Basel wurde vom Publikum begeistert applaudiert.
Hintergründe in Vorträgen und Diskussionen
Der künstlerische Leiter Hans-Georg Hofmann, bis vor Kurzem beim Sinfonieorchester Basel tätig, legte Wert darauf, dass das Festivalprogramm durch zahlreiche Einführungsvorträge, Lesungen und Podiumsdiskussionen mit wichtigen Hintergrundinformationen abgerundet wurde. Man erfuhr unter anderem, wie vielgestaltig die sowjetische Musik war und dass im Westen nur ein Bruchteil davon bekannt ist. Auch dass sich das Bild von Schostakowitsch in den 50 Jahren seit seinem Tod ständig verändert hat: War er nun ein Dissident, eine Galionsfigur oder eine Faust-Gestalt, die einen Pakt mit dem Bösen geschlossen hatte? Dass Stalin, der uns als Verkörperung des Bösen an sich erscheint, ein reges Interesse an Musik hatte, wird oft vergessen. Besonders erschütternd war Michail Schischkins Erinnerung an Véronique Lautard-Schewtschenka (1901–1982), eine französische Pianistin, die aufgrund einer unüberlegten Äusserung für Jahre im Gulag verschwand und nach ihrer Freilassung trotz widrigster Umstände viele Menschen mit ihrem Klavierspiel berührte.
Angesichts dieser Vermittlungsbemühungen ist es schade, dass für das Publikum nur eine Broschüre mit rudimentären Angaben zum Programm ohne Satzbezeichnungen, Entstehungsjahre und Biografien der Komponisten auflag. Und vielleicht wären noch mehr Interessierte zu einem Besuch des Festivals verleitet worden, wenn es anstelle des zweideutigen «Macht Musik» einen aussagekräftigeren Titel gehabt hätte.