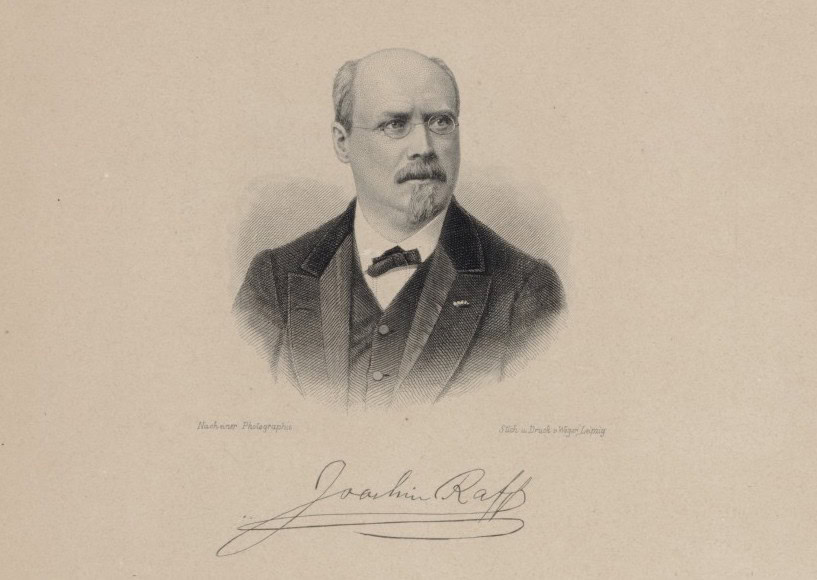Zugänge zum schwer Zugänglichen
«Listening Lab» bietet Materialien und Arbeitsvorschläge, um mit Kindern und Jugendlichen Schlüsselwerke der Neuen Musik zu entdecken.

Wie Neue Musik vermitteln? Wie kann eine als unzugänglich empfundene Musik im Unterricht erschlossen werden? Die Universal Edition hat mit Listening Lab eine Heftreihe begonnen, die Wege zu einer breit angelegten, alle Sinne beteiligenden Annäherung aufzeigen.
Die einzelnen «Workshops» innerhalb der Hefte richten sich an unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt Projekte und Spiele sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene. Doch, so meinen die Autoren, diese Angaben zum Zielpublikum seien nicht absolut zu verstehen, vielmehr gehe es darum, die Sprache und Arbeitsweise den Gruppen anzupassen.
Zwölftonreihe als Grundlage
Als erstes stellen Constanze Wimmer und Helmut Schmidinger Materialien rund um das Violinkonzert von Alban Berg vor. Dieses Werk gilt vielen als eines der wichtigsten Konzerte im 20. Jahrhundert. Zu Beginn ertönen die leeren Saiten der Geige G-D-A-E. Aus diesen vier Tönen entwickelt sich gleichsam das Stück, dem eine Zwölftonreihe zugrunde liegt. Ein Kärntner Volkslied (Ein Vogerl aufm Zwetschgenbaum) und ein Bachchoral (Es ist genug) sind in das Stück verwoben, es kommen ein Walzer und der Rhythmus eines Totentanzes vor. Alles Ingredienzen, die den aussermusikalischen Kontext spiegeln. Denn Berg widmet sein Werk Manon Gropius, der Tochter von Alma Mahler, die 19-jährig an Polio stirbt, und untertitelt es mit «Dem Andenken eines Engels». Tod und Trauer, Schmerz und Liebe sind in dieser Musik spürbar.
Aus der Musik selber und aus der Geschichte, die diese umgibt, gewinnt Constanze Wimmer die Zugänge zum Werk. Zum Beispiel bei der «Quintensuche»: Paarweise werden Quinten gesungen, eine Person gibt einen Ton vor, die andere sucht den Quintton. Oder es gilt die zuvor verstimmten Streichinstrumente richtig zu stimmen. Eigene, persönliche Zwölftonreihen entstehen, indem man die Buchstaben seines eigenen Namens als Musiknoten notiert und die Tonfolge anschliessend mit dem Stabspiel ausprobiert. Im «Projektvorschlag Porträtklangmalerei» zeigen praktische Konzepte, wie mit eigenem Spielen, Komponieren und Experimentieren in die Welt von Bergs Violinkonzert eingetaucht werden kann.
So bietet das Heft vielerlei Anregungen und Tipps für den Unterricht. Dazu gibt es reiche Hintergrundinformationen, besonders interessant die vielen Zitate von Th. W. Adorno und Willi Reich.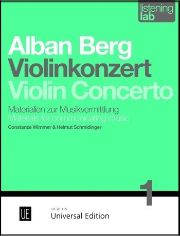
Textur aus 80 Stimmen
Atmosphères! György Ligeti Werk ist ein Klangkoloss, flirrend, unfassbar, verstörend. Aber schon bei seiner Uraufführung 1961 in Donaueschingen wurde den Zuhörern sofort klar, dass es sich um etwas Neues, wirklich Neues, handelte. Ein musikalischer Markstein des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde das Stück durch Stanley Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum.
Wie in diese Clusterklänge eintauchen ohne unterzugehen und wegzuhören? Die Melodien der 80 Einzelstimmen wirken wie ein textiles Gewebe, mal eng-, mal weitmaschig gewoben. Es gibt keine klar abgegrenzten Formteile, keine Wiederholungen, keine markanten melodischen oder rhythmischen Gestalten, keine kontrastierenden Themen. Die Klangfelder überlagern sich und fliessen ineinander über, wie die Farben in den Ungemalten Bildern Emil Noldes.
Die Autoren Veronika Grossberger und Johannes Voit nähern sich dem Stück auf verschiedenen Ebenen. Mittels Recherche (Analysen und Zitate), Hören, Erfinden, Imagination und Interaktion: Hören der Filmmusik: Welche Funktion erfüllt die Musik im Film? Was bewirken die Atmosphères in Kubricks Weltall? Erfinden: Man erfinde einen ungewöhnlichen Klang auf einem Instrument oder irgendeinem Gegenstand. Damit gehts auf einen fremden Planeten – was passiert dort? Erfinde eine Geschichte und vertone sie … Imagination: Man beobachte die Wolken. Wie sie sich verändern, verformen, sich auflösen. Tempo, Dynamik, Konsistenz. Interaktion: Luftklänge erforschen – auf Blasinstrumenten, auf Saiten- und Schlaginstrumenten, mit dem eigenen Körper. Eine Atmosphäre schaffen. Klangwolken steigen auf. Vielleicht in einer Gruppenimprovisation. Dazu die Spielanweisungen aus der Partitur – senza colore, molto vibrato. Wann beginnt ein Klang zu vibrieren? Wann erstarrt er? Diese Klänge lassen sich in eine pantomimische Darstellung umsetzen.
Der Schwerpunkt der Materialien liegt auf erlebnisorientierten und aktivierenden Settings, aufbereitet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.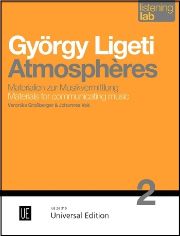
Unvollendetes vervollständigt
Um gleich ein mögliches Missverständnis auszuschliessen: Es geht nicht um Schuberts Unvollendete in h-Moll, D 759, sondern um die 10. Sinfonie (D 936A), die nur in Skizzen vorliegt. In Rendering aus dem Jahre 1989 unternimmt der italienische Komponist Luciano Berio den Versuch, diese Fragmente und Skizzen von Schuberts Zehnter zusammenzufügen und zu einem komplett orchestrierten Werk zu vervollständigen. Dabei ergänzt er die Musik Schuberts mit eigenen Kompositionen. Berio tut das auf eine respektvolle Weise. In seinen Restaurierungen, Rekonstruktionen und musikalischen Ergänzungen integriert er Schuberts Motive. Auch die formale Anlage und die Besetzung des Orchesters (mit Ausnahme der Celesta) richten sich nach den Vorgaben Schuberts. Und doch entsteht eine neue Musik mit Klangflächen, die Berio als seinen «musikalischen Zement» bezeichnet, mit denen er die Fragmente verkittet.
Wer ist Luciano Berio? Wie vollendet er Schuberts Musik? Wie sich Rendering annähern? Wie in den übrigen Heften greifen die Autoren auf das Muster von «Recherche, Imagination und Interaktion» zurück. So wird in den Recherche-Teilen dem Phänomen der unvollendeten Sinfonien nachgegangen, nicht nur denjenigen von Schubert, auch bei Beethoven und anderen. Das Aufeinandertreffen von alt und neu ist Thema in den Imaginationen. Schubert und Berio, vergangen und gegenwärtig. Wie verzahnen sich Zeiten und Personen, Erinnerungen und Neuschöpfungen? Ausgehend von den Metamorphosen, einer Bilderreihe M. C. Eschers, werden Übergänge – Schnittflächen und Schnittpunkte in den Bildkompositionen, musikalische Überlagerungen in den Klangkompositionen – dargestellt. In den Interaktionen gehts ums Komponieren, ums Selbermachen, beispielsweise indem man eine Melodie mit Lücken selbst mit Musik auffüllt. Was also macht ein Komponist (so der Titel eines Projektvorschlags)? Er spielt mit Bausteinen und erfindet spannende Geschichten! Hier finden sich inspirierende Anleitungen dazu.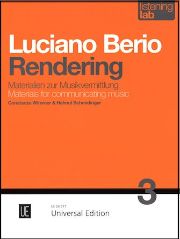
In den neuesten Heften geht es um die Notations von Pierre Boulez und Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta.
Constanze Wimmer, Helmut Schmidinger, Alban Berg Violinkonzert. Materialien zur Musikvermittlung, Listening Lab 1, UE 26315, € 39.95, Universal Edition, Wien
Veronika Grossberger, Johannes Voit, György Ligeti Atmosphères. Listening Lab 2,
UE 26316, € 39.95
Constanze Wimmer, Helmut Schmidinger, Luciano Berio Rendering, Listening Lab 3,
UE 26317, € 39.95