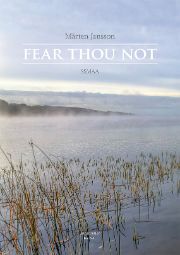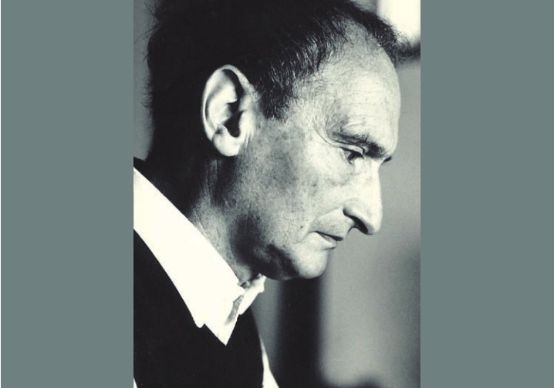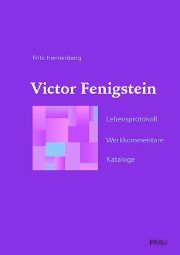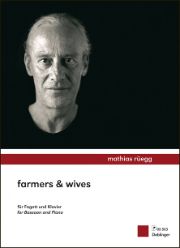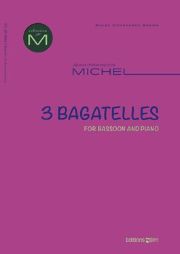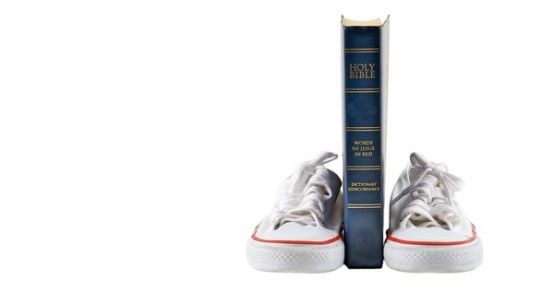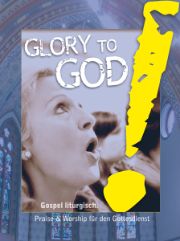Chorwerke von Marten Jansson
Der Bedarf an neuer, gut singbarer und wohlklingender, diatonisch orientierter Chormusik scheint gross. Besonders in Nordeuropa treten immer wieder Komponisten in Erscheinung, die diesem Bedürfnis entgegenkommen

Wie in jedem Stilbereich gibt es auch hier besser und schlechter Gelungenes. Die Stücke von Mårten Jansson gehören eindeutig der ersten Kategorie an. Der Bärenreiter-Verlag hat drei davon in ansprechender Aufmachung veröffentlicht.
Fear thou not für fünfstimmigen Frauenchor überzeugt durch filigranen, immer durchsichtigen Satz mit einfachster Motivik, die nach ostinatoartigem Beginn sich immer weiter entfaltet. Dabei ist der gesamte, Frauenstimmen zugängliche Klangraum klug ausgeschöpft. Wirklich leicht ist das Stück nicht, besonders in der melodisch führenden Sopranstimme finden sich ab und zu grosse Sprünge (die jedoch immer harmonisch abgefedert sind), und ein hohes c“‘ ist zwingend verlangt. Jansson rechnet auch auf der anderen Seite des Spektrums mit extrem tiefen Altstimmen, ist aber klug genug, hier Ossia-Lösungen anzubieten. Das auf dem Jesaja-Text «Fürchte dich nicht, ich bin bei dir» basierende Stück bleibt harmonisch in einem leicht erweiterten c-Moll-Rahmen inklusive Verklärung nach C-Dur am Ende des Stückes.
Ganz ähnlich lässt sich Maria (IV) für vierstimmig gemischten Chor an, der Sopran ist allerdings über weite Strecken geteilt. Die Tonart es-Moll wird bald verlassen und über verschiedene Stationen, oft mittels chromatischer Wege (und dank ausgearbeiteter Stimmführung problemlos realisierbar) nach e-Moll aufgehellt. Auch in diesem Stück ist der Sopran die melodisch anspruchsvollste Stimme, die anderen teilen sich die Aufgabe der harmonischen Grundierung. Für diese Musik braucht man einen gut intonierenden und klanglich ausgewogenen Chor, der auch im Umgang mit erweiterter Harmonik geschult ist. Das Stück wird in zwei Sprachfassungen, dem originalen Schwedisch und in Englisch angeboten. Beim Text handelt es sich um eine Art modernes Mariengedicht, zugänglich also auch für protestantische Chöre, die sich mit den altüberlieferten katholischen Marienanbetungen schwer tun.
The Choirmasters Burial setzt einen leicht anderen Akzent: nach einstimmigem, volksmusikartigem Beginn des Tenors hebt ein klanglich satter Männerchor an, der dann durch den Frauenchor ergänzt wird. Dieses Stück verlangt einen gleichmässig gut besetzten, nicht zu kleinen Chor. Auch hier sind die Randlagen ausgereizt(hoher Sopran bis h“; tiefer Bass bis H, mit ossia), können sogar durch zwei optional addierbare Frauenchöre noch weiter gespreizt werden (Sopran bis d“‘). Gut finde ich auch bei diesem Stück, dass die Tonart F-Dur nicht überstrapaziert, sondern durch andere klangliche Regionen aufgelockert wird. Der englische Text des viktorianischen Schriftstellers Thomas Hardy erzählt von einem Chorleiter, der gegen seinen Wunsch und auf Betreiben des Vikars ohne jede Musik beerdigt wird – worauf diesem Vikar in der folgenden Nacht eine «Band of Angels» erscheint, die unter der Leitung des verstorbenen Chormeisters musiziert. Integriert in dieses Stück sind einige Verse aus dem liturgischen Requiem-Text.
Mårten Jansson, Fear thou not für Chor SSMAA, Chorpartitur, BA 7411, € 3.95, Bärenreiter, Kassel 2014
id., Maria (IV), für Chor SATB, BA 7412, € 3.95
id., The Choirmaster’s Burial, für Chor SSATBB, BA 7413,
€ 5.95