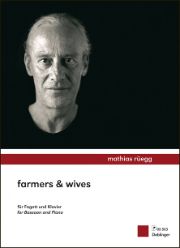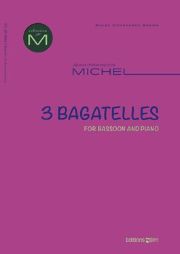Musik für Fledermäuse
Wir begreifen Stille üblicherweise als Abwesenheit von Geräuschen. Tatsächlich ist Stille aber etwas anderes, nämlich die Unfähigkeit unserer Ohren, alle Frequenzen wahrzunehmen. Einige wenige Komponisten haben die paradoxe Idee verwirklicht, mit unhörbaren Frequenzen zu arbeiten, jeder auf eine andere Art.
Wir begreifen Stille üblicherweise als Abwesenheit von Geräuschen. Tatsächlich ist Stille aber etwas anderes, nämlich die Unfähigkeit unserer Ohren, alle Frequenzen wahrzunehmen. Einige wenige Komponisten haben die paradoxe Idee verwirklicht, mit unhörbaren Frequenzen zu arbeiten, jeder auf eine andere Art.
Es gibt Töne, die können wir nicht hören, aber fühlen. Angeblich wussten das schon die alten Orgelbauer und haben darum eine 64-Fuss-Pfeife, eine sogenannte Demutspfeife konstruiert. Ihr Grundton, das Subsubkontra-C von etwa 8Hz, liegt im Infraschallbereich – in einem Frequenzbereich, den wir, wenn überhaupt, körperlich wahrnehmen – und sollte den frommen Kirchgängern gehörig Ehrfurcht einflössen. Infraschall kann beim Zuhörer Unwohlsein hervorrufen, weil der Körper die Wellen zwar spürt, aber nicht recht lokalisieren kann. Hören kann man so eine Pfeife aber schon, denn in ihr schwingen ja die diversen Obertöne mit. Nur der Grundton ist unhörbar und in seiner Wirkung etwas gespenstisch. Weltweit besitzen nur zwei Orgeln ein voll ausgebautes (also bis zum C hinabreichendes) 64-Fuss-Register. Aber als Demutspfeifen, um dem Hörer Demut einzupfeifen, werden sie nicht mehr benutzt. Ob dieses provozierte Unwohlsein im Gottesdienst überhaupt die erhoffte Portion Ergebenheit hervorrufen konnte, ist ungewiss.
Gewiss ist aber, dass der Frequenzbereich, den wir hören können, beschränkt ist. All das Piepsen, Schnaufen, Grummeln und Rattern, das einem etwa während einer Zugfahrt ans Ohr dringt, spielt sich zwischen den Frequenzen 20 Hz und 20 kHz ab. Das menschliche Ohr hat sich auf diesen Bereich spezialisiert; die Musik logischerweise auch. Aber ein paar Exoten gibt es dennoch, die bewusst mit den abseitigen Frequenzen spielen. In dieser unhörbaren Welt gibt es Infraschall und Ultraschall. Schallwellen mit einer Schwingfrequenz unter 20 Hz gehören zum Infraschall, Schallwellen mit einer höheren Schwingfrequenz als 20 kHz sind Ultraschallwellen. Beide kann der Mensch nutzbar machen, aber nicht unmittelbar hören. Wenn man also glaubt, nichts zu hören, so schwirren unbemerkt lauter Infra- und Ultraschallwellen um einen herum. Tiere benutzen diese anderen Frequenzbereiche zur Kommunikation. Fledermäuse hören Schwingungen von 15 kHz bis 200 kHz, also weitgehend im Ultraschallbereich. Elefanten hören tiefe Frequenzen. Sie könnten also musikalischen Gefallen an einzelnen Tönen des 64-Fuss-Registers finden – würden sie je den Weg in eine damit ausgestattete Kirche finden.
Die Performance-Künstlerin Laurie Anderson hat ihre musikalische Zielgruppe weniger exotisch gewählt: Hunde. Im Jahr 2010 führte sie ihre Music for dogs erstmals vor der Oper in Sydney auf. Zahlreiche Hundebesitzer brachten ihr Lieblingstier zu dem Event mit. Auf youtube gibt es einen kurzen Clip, in dem die Hunde erwartungsfroh in die Kamera blicken. Wie die Vierbeiner diese musikalische Liebeserklärung wahrgenommen haben, kann man nicht sagen; sie machten auf alle Fälle einen vergnügten Eindruck. Die Halter hatten ebenfalls ihren Spass an dem konzeptuellen Hunde-Humbug; Andersons Musik – rhythmisch, elektronisch, mit vielen Sweep-Sounds – liegt nicht vollständig ausserhalb des menschlichen Hörbereichs, schliesslich teilen sich Herrchen und Hund zwangsläufig einige Frequenzen.
Das Spiel mit dem Unhörbaren gibt es aber auch in Musikstücken ohne tierischen Bezug: Eduardo Moguillansky hat sich in seinem Stück bauauf an die Hörgrenze des Menschen begeben. Diese sinkt im Laufe des Alters, so dass junge Menschen hohe Frequenzen um 20 kHz noch wahrnehmen können, ältere Menschen aber nicht. Bei Eduardo Moguillansky teilt die elektronische Zuspielung das Publikum in Nicht-Hörer und Hörer. Vom Band erklingen Frequenzen um 17 kHz; ein junger Mensch sollte die Töne noch hören können. Für Moguillansky läuft diese Trennung des Publikums entlang einer konkreten Jahreszahl: 1982, dem Jahr, in dem die Diktatur in Argentinien zu Ende ging. Jeder vor 1982 Geborene, der somit die Diktatur noch miterlebt haben könnte, würde die Töne nicht mehr hören. Diese sonderbar hohen Frequenzen tragen insofern eine zarte politische Dimension in sich, als sie das Umbruchsjahr 1982 durch Physiologie auf die Musik projizieren. Diese Hörbarkeitsgrenze gilt allerdings so scharf, wenn überhaupt, nur ideellerweise; denn die Hörfähigkeit ist von Mensch zu Mensch verschieden, und weil zudem jeder Mensch altert, verschiebt sich auch die Jahresgrenze, die die Zuhörer spaltet, im Laufe der Zeit. Die elektronisch zugespielten hochfrequenten Töne sind aber nur ein passiver Bestandteil von bauauf. Moguillansky hat sich auch in den für alle hörbaren Tönen mit der argentinischen Diktatur beschäftigt, genauer mit den sinnlosen, aber systemerhaltenden Arbeitsprozessen dieses Staatsapparats, dem sogenannten «proceso de reorganización national». Vier Musiker interpretieren bauauf; sie spielen dabei selten auf ihren traditionellen Instrumenten, sondern meist mit kleinen Holzgegenständen auf hölzernen Kisten. Wie brave Bürokraten erfüllen sie sitzend ihre Anweisungen, halten damit das grosse Getriebe am Laufen, können aber das Ziel hinter den Einzelaktionen nicht erkennen. Eine absurde Stempel-Station auf einem Amt …
Moguillansky und sein politisch konnotiertes Spiel mit dem Unhörbaren ist ein Sonderfall in der unhörbaren Musik, weil es ja eine Teilgruppe gibt, die den Ton hören kann. Wobei natürlich die unhörbare Musik an sich ein Spezialfall ist – wie soll man sie aufführen, wenn sie bei der Aufführung aufgrund der Unhörbarkeit unfreiwillig wie Cages 4’33“ klingt? Die Klangkünstlerin Jana Winderen und der Komponist Wolfgang Loos alias KooKoon haben jeweils eine eigene Herangehensweise an die unhörbaren Frequenzen gewählt, die dieses Dilemma löst: Sie machen sie hörbar. Infraschall muss schneller abgespielt werden, damit die Schallwellen in den hörbaren Bereich verschoben werden, Ultraschall dagegen muss verlangsamt werden. Und plötzlich kann man hören, wie Ameisen plaudern, wie Elefanten sich austauschen, ja sogar wie ein Erdbeben klingt. Das Unhörbare hörbar zu machen, hat eine öko-soziale Dimension. Im für uns Unhörbaren kommunizieren Tiere, da spricht die Welt. – Das Unhörbare in hörbare Musik zu verwandeln ist aber nicht so einfach. KooKoon hat zusammen mit Frank Scherbaum, Professor für Geophysik, die tieffrequenten seismischen Wellen einer Formanten-Analyse unterzogen und aus den Ergebnissen eine fünfsätzige seismosonic symphony komponiert; Musik, die nur aus den transformierten seismischen Wellen besteht. Während es bei KooKoon tatsächlich grummelt und schwer atmet – wie man es vom Erdbeben auch erwartet, entführt Winderens Klangkunst out of range den Hörer in die akustische Welt einer Bodenritze. Es kruschelt und gluckst im Ohr, als würde man der brownschen Molekularbewegung lauschen.
Die Verwandlung von unhörbaren Schallwellen in für uns hörbare ist übrigens auch umkehrbar, das heisst, man kann ohne weiteres ein Musikstück wie Beethovens Fünfte in einen höherfrequenten Bereich übertragen. Und so gäbe es sie auch noch: Musik für Fledermäuse.