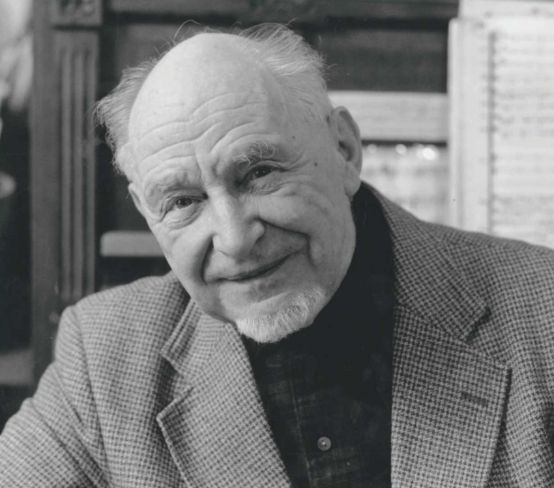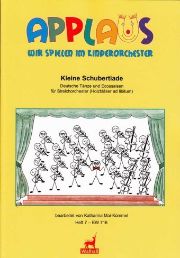Wenn wir Noten kaufen, auf denen das Wort «Urtext» prangt, dürfen wir erwarten, dass des Komponisten unverstellter Wille drinsteckt. Dass dies nicht immer so einfach ist, zeigen zwei neuere Ausgaben des beliebten Bläsersextettes Mládí (Jugend, komponiert 1924) von Leoš Janáček.
Die Quellenlage von Janáčeks Geniestreich ist in der Tat so verwirrend und vielschichtig, dass man bereits von vornherein ausschliessen kann, dass zwei unabhängige Editionen zu denselben Ergebnissen gelangen, was denn bei den beiden zur Debatte stehenden Ausgaben auch zu beobachten ist. Nebst einem Autograf existieren mehrere autorisierte Partitur- und Stimmenabschriften, aus denen bei der Uraufführung in Brünn und bei der Zweitaufführung in Prag (durch verschiedene Ensembles) gespielt wurde und die allesamt Einträge beinhalten, die teils von Komponistenhand teils durch beteiligte Musiker während der Proben mit Janáček stammen und somit berechtigten Anspruch auf Authentizität stellen dürfen. Dabei handelt es sich zum einen um zahlreiche Modifikationen der Tempoangaben, um alternative Versionen einzelner Takte und Figuren bis hin zu Oktavierungen und Instrumentationsänderungen. Als weitere Quellen können der Erstdruck der Partitur dienen – in welchen freilich nicht alle Änderungen der beiden Aufführungen eingingen – sowie der Stimmensatz, der zwei Monate nach der Partitur erschienen ist und in mehreren Details von der Partitur abweicht.
Wie gehen nun zwei renommierte Verlage mit dieser etwas chaotischen Quellenlage um? Als durchwegs vorbildlich muss die Henle-Ausgabe von Jiří Zahrádka bezeichnet werden. Das Vorwort erklärt anschaulich und detailliert die editorischen Knacknüsse und illustriert einige der autografen Korrekturen mit Reprints der Quellen. Den ausführlichen Kritischen Bericht stellt der Verlag ausserdem als 18-seitigen Download zur freien Verfügung. Zudem finden zahlreiche Bemerkungen wie etwa verschiedene Tempoangaben sowie Ossias Eingang in den Notentext (ganz wichtig: auch in die Stimmen!), damit sich auch während der praktischen Arbeit eine Auseinandersetzung mit den Quellen ergeben kann. Ein grosszügiger und exzellent lesbarer Druck ohne unangenehme Wendestellen runden den ausgezeichneten Gesamteindruck ab.
Bei der Bärenreiter-Ausgabe von Jan Doležal und Leoš Faltus wird der Eindruck mehrfach getrübt: Ein ausschweifend formuliertes Vorwort erklärt den Sachverhalt der Quellenlage nur ungenügend, für Anmerkungen und detaillierte Erklärungen zur Edition wird auf die Gesamtausgabe verwiesen, was einen Gang in eine Bibliothek unumgänglich macht. Der Druck wirkt gedrängt, die Taktwechsel sind schwer lesbar (weil sie über dem System stehen und nicht darin intergriert sind), und die Stimmen enthalten ungünstige Wendestellen. Wirklich dramatisch sind aber unkommentierte und nicht als solche gekennzeichnete Zusätze der Herausgeber wie beispielsweise die Triller im 1. Satz (T. 34), das mf der beiden Bassstimmen im 2. Satz (T. 7) und die offensichtlich falsche Tempoangabe bei der Reminiszenz an das 2. Thema des 1. Satzes (T. 142 im 4. Satz: MM. 72 für den punktierten Viertel anstatt für den Achtel). Ebenfalls sehr problematisch ist die Erfindung der Tonartenvorzeichen im 3. und 4. Satz: bis zu 7 häufig wechselnde Vorzeichen müssen die Ausführenden akzeptieren, was ein fehlerloses Spiel praktisch verunmöglicht (der Rezensent hat es mit einem sehr guten Ensemble ausprobiert!), da die Musik keineswegs als «logisch tonal» bezeichnet werden kann. Janáček wusste eben genau, was er tat, als er die Vorzeichen in den Notentext integrierte, was eine Urtextausgabe unbedingt zu beachten hätte.
Wenn man berücksichtigt, dass der Bärenreiter-Verlag das Werk innerhalb der Gesamtausgabe bereits vor 15 Jahren veröffentlichte, ist Hoffnung angebracht. Hoffnung darauf, dass seither ein Umdenken stattgefunden hat und die Verlage die Interpretinnen und Interpreten von heute auch mit einer komplexen Quellenlage konfrontieren dürfen. Diese brauchen nämlich keinen Notentext, der vorgaukelt, dass alles ganz zweifelsfrei und eindeutig sei, sondern eine sinnvolle und umfassende Darstellung der Quellenlage, um dann zu eigenständigen Entscheidungen zu gelangen.
Leoš Janáček, Mládí (Jugend), Suite für Blasinstrumente (Flöte/Piccolo, Oboe, Klarinette B, Horn F, Fagott, Bassklarinette B)
hg. von Jirí Zahrádka; Stimmen, HN 1093,
€ 27.00; Studienpartitur,
HN 7093, € 16.00;
G. Henle, München 2015
id., hg. von Leos Faltus und Jan Doležal; Stimmen, BA 9528, € 22.95; Studienpartitur, TP 528,
€ 18.95; Bärenreiter, Prag 2009, Einzelausgabe der Kritischen Janáček-Gesamtausgabe, 2001