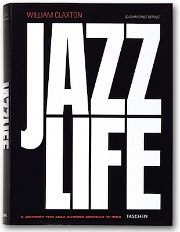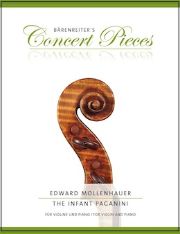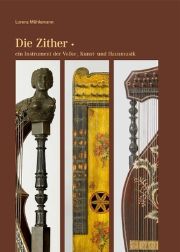Ich bin zuständig für Möglichkeiten
Im Rahmen des Luzerner Piano-Festivals Mitte November gab der amerikanische Pianist und Musikforscher Robert Levin einen Meisterkurs. Zentral war einmal mehr die Erkenntnis, dass korrektes Umsetzen eines Notentextes noch nicht grosse Kunst ist.

Zwei moderne Konzertflügel stehen nebeneinander im Rittersaal der St. Charles Hall. Auch einen historischen Hammerflügel hat Robert Levin in den mit Gobelins und Deckenmalerei reich dekorierten Raum bringen lassen, um während seiner öffentlichen Masterclass in Meggen bei Luzern noch mehr Möglichkeiten zur Gestaltung zu haben. Und um der chinesischen Klavierstudentin Ke Ma zu zeigen, wie die hüpfenden Bässe im Presto von Beethovens Mondscheinsonate zur Zeit des Komponisten wohl geklungen haben. Der US-Amerikaner, der mühelos zwischen Englisch und Deutsch hin- und herwechselt, klärt auf über die korrekten Triller, entdeckt offensichtliche Druckfehler in der Urtextausgabe von Johann Sebastian Bach und verdeutlicht Brahms’ Liebesschmerz, indem er harmonische Wendungen in dessen zweitem Intermezzo op. 117 analysiert: «So stark zeigt Brahms seine Gefühle selten. Hier bricht er regelrecht zusammen.»
Auch für die rund 30 Zuhörer ist es interessant, wenn Robert Levin spieltechnische Tipps gibt oder musikalisch nachweist, dass Bach einige Themen wörtlich von Antonio Vivaldi geklaut hat. Die Atmosphäre im kleinen Saal ist konzentriert. Durch die hohen Fenster schaut man auf den Vierwaldstättersee und schneebedeckte Berge. Der jährliche Klavier-Meisterkurs der Luzerner Musikhochschule, die in Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival Piano veranstaltet wird, findet 2016 zum fünften Mal statt. Leon Fleisher, Andreas Haefliger und Martin Helmchen waren die Leiter der letzten Jahre. Robert Levin ist nach 2014 bereits zum zweiten Mal dabei. «Er kann mit seinem musikwissenschaftlichen Background gerade auch in Interpretationsfragen den Studierenden sehr wertvolle Hinweise geben», sagt Michael Kaufmann, Rektor der Luzerner Musikhochschule. Finanziert wird die Masterclass aus einem speziellen Fonds der Stiftung Musikförderungen an der Hochschule Luzern – Musik. Fünf der zehn Teilnehmer sind Luzerner Studenten von Konstantin Lifschitz. Die anderen kommen aus China, England, Deutschland und den USA. Die Schweizerin Marija Bokor (Jahrgang 1992) hat bereits die erste Masterclass von Robert Levin besucht. «Er ist so ansteckend in seinem Enthusiasmus. Viele Dinge, die er sagt, haben mich als Pianistin sehr verändert. Seine Denkweise färbt richtig ab.» Beim letzten Kurs habe sie noch viel geübt zwischen den Unterrichtseinheiten. Dieses Mal sei sie fast die ganze Zeit beim Unterricht der Kollegen dabei gewesen und habe zugehört. Die 22-jährige Ke Ma wurde noch zu Schulzeiten in China auf Luzern aufmerksam, als sie ein Video von Yuja Wangs Interpretation von Prokofiews drittem Klavierkonzert unter Claudio Abbado aus dem KKL sah. Über Internetrecherche sei sie auf die Masterclass gestossen. «Ich habe bei Robert Levin viel Grundsätzliches gelernt, beispielsweise über die optimale Handposition. Das kann man auf alle Stücke übertragen. Interessant fand ich auch, was er über die verschiedenen Charaktere bei Mozart erzählt hat. Und natürlich seine Anekdoten aus dem Musikleben.» In den Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden wird viel getratscht. Es geht herzlich zu zwischen den Hochbegabten. Konkurrenzdenken ist nicht zu spüren.
Nach dem viertägigen Kurs ist Robert Levin sehr zufrieden. «Ich freue mich immer, wenn die Studenten selbst merken, was sie alles bewirken können.» Zum Hammerflügel, einer Leihgabe der Musikhochschule, meint er: «Es ist einfach wichtig, dieses Instrument selbst ausprobieren zu können. Der Anschlag ist ganz anderes als auf einem modernen Konzertflügel.» Levin, der trotz seiner 69 Jahre immer noch jugendlich wirkt, möchte bei seinen Studenten das Interesse für die «Korrektheit der Sprache» wecken. «Dabei bin ich nicht zuständig für die Lösungen, sondern für die Möglichkeiten. Ich möchte die Fenster öffnen», sagt er mit einem Lächeln. Dazu gehört für ihn auch ein philologisches Interesse. Es gebe Unterschiede zwischen einem norddeutschen Staccato und einem süddeutschen. Ein Fortissimo bei Brahms sei etwas ganz anderes als bei Chopin. Letzten Endes gehe es aber um viel mehr als das möglichst einwandfreie Umsetzen von musikalischer Notation. «Ohne Risiko passiert nichts. Wir müssen uns als Musiker der heiligen Pflicht widmen, das Leben unserer Mitmenschen zu verbessern.» Diese moralische Dimension der Kunst habe ihm seine Lehrerin Nadia Boulanger vermittelt. Auch diesen Anspruch gebe er im Meisterkurs weiter – und stosse damit auf offene Ohren.
Beim Abschlusskonzert in der Lukaskirche gestaltet Anna Zaychenka schöne Farbwechsel in den späten Klavierstücken op. 118 von Johannes Brahms. Kathy Tai-Hsuan Lees sprechende Beethoven-Interpretation hat Wucht. Marija Bokor lässt Debussys Estampes wie hinter Nebel erscheinen. Ke Mas Chopin entfaltet Eleganz und Kraft, Gunel Mirzayevas Bach verbindet Strenge mit Spielfreude. Nach Daniel Evans klarer Gestaltung des Kopfsatzes aus Chopins 3. Klaviersonate in h-Moll gehen die Studenten mit Robert Levin ins KKL, um Grigory Sokolov beim Eröffnungskonzert des Lucerne Festivals Piano zu lauschen. Und um auch hier zu erkennen, dass grosse Kunst viel mehr ist als technisch korrektes Klavierspiel.
Website des Lucerne Festivals