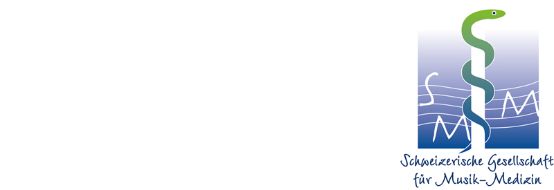Ein aktuelles Beispiel ist die 17-jährige Geigerin Elea Nick aus Meilen. Wir treffen uns zu einem Gespräch im Au Premier am Hauptbahnhof Zürich, sie ist eine schlichte, sympathisch natürlich wirkende junge Frau und wird von ihrer Mutter und Managerin Cornelia Nick begleitet. Für ihr Tonhalle-Debüt am 1. November hat sie Tschaikowskys Violinkonzert ausgewählt, das sie mit den Zürcher Symphonikern unter der Leitung von Mario Beretta spielt. Eine mutige Stückwahl, handelt es sich dabei doch um eines der schwierigsten Violinkonzerte überhaupt.
Das Russische hat die jugendliche Geigerin über ihren Lehrmeister, den russischen Geiger Zakhar Bron, vermittelt bekommen, bei dem sie seit sechs Jahren studiert. Als jüngste Studentin überhaupt konnte sie an der Zürcher Hochschule der Künste, wo ihr Vater Andreas Nick Theorie lehrt, den Unterricht bei Bron besuchen. Seit seiner Pensionierung 2015 baut Bron in Interlaken eine Musikakademie für Hochbegabte auf, Elea Nick besucht ihn dort regelmässig. Sein Ruf als Geigenpädagoge ist legendär, Stars wie Vadim Repin, Maxim Vengerov, Daniel Hope, Laura Marzadori oder David Garret waren einst unter seinen Fittichen. «Die russische Geigenschule und die Art, wie Bron unterrichtet, liegen mir», meint Elea Nick selbstbewusst. «Er ist extrem genau, jeder Ton hat seine Bedeutung, und er lässt nicht locker, bis man diese gefunden hat.» Tschaikowskys Violinkonzert entspreche ihr, in der Tonhalle wird sie es erstmals öffentlich spielen.
Konzentration auf die Karriere
Schaut man sich die Stationen der noch jungen Karriere Elea Nicks an, so hat sie in der Schweiz auf den üblichen Plattformen auf sich aufmerksam gemacht: Sie gewann mehrmals den Schweizer Jugendmusikwettbewerb, als Geigerin und Kammermusikerin, zudem hat sie 2015 einen Migros-Studienpreis gewonnen. International hat sie bereits an zwei Wettbewerben reüssiert: In Nowosibirsk erreichte sie 2013 den ersten Rang ausgezeichnet, in Lublin beim internationalen Lipinski-Wieniawski-Wettbewerb 2015 mit einem ersten Preis.
So weit so gut. «Doch eine solistische Karriere kann man so wenig planen wie das Glück, auch wenn zu ihrer Erzwingung alles richtig gemacht wird», meint der international gefragte Schweizer Pianist Oliver Schnyder, der die Jury zur Vergabe der Migros-Preise präsidiert. Die Konkurrenz unter den jungen Hochbegabten ist riesig, entscheidend fürs Weiterkommen sind persönliche Kontakte in die Musikwelt, aber auch, ein eigenes künstlerisches Profil zu entwickeln.
Wettbewerbe sind nach wie vor wichtig, um auf sich aufmerksam zu machen. «Zudem ist die Vorbereitung auf einen Wettbewerb sehr intensiv», meint Elea Nick, «man muss sich mit einem Riesenprogramm auseinandersetzen, und das auswendig. Dies ist eine extrem gute Vorbereitung fürs Konzertleben.»
Was die Kommunikation betrifft, so ist Elea Nick auf Facebook präsent, sie postet alle Nachrichten selber. Laut Oliver Schnyder spielt die PR heute zwar eine wichtige Rolle, «aber erst dann, wenn die jungen Künstlerinnen und Künstler sehr genau spüren und wissen, was sie unverwechselbar macht. Entsprechend müssen sie die künstlerischen Projekte verfolgen, die ein Image so definieren und festigen, dass es eine PR-Agentur aufgreifen und verwertet kann. Es muss authentisch, unverwechselbar und charismatisch sein.»
Die Förderstrukturen in der Schweiz brauchen heute, so Schnyder weiter, den internationalen Vergleich nicht mehr zu scheuen. «Früher mussten die Jungen kämpfen wie die Löwen, um sich von den gleichmacherischen Tendenzen des Systems nicht bremsen zu lassen.» Elea Nick hatte das Glück, in Meilen bis zur dritten Sekundarstufe die normale Schule besuchen zu können, man erlaubte ein ermässigtes Schulpensum. Nun macht sie im Akad College im Lehrgang Kunst und Sport die Matura im Selbststudium. Auch im schulischen Bereich scheint man in der Schweiz für Hochbegabte flexibler geworden zu sein.