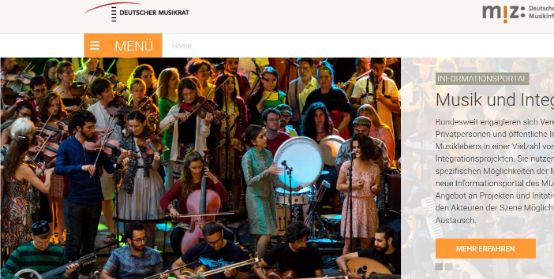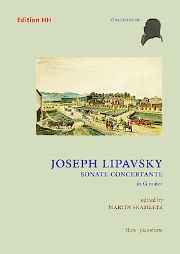PGM: Treten an Ort
Am 7. März trafen sich Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe Musik (PGM) mit Abgeordneten verschiedener Musikinstitutionen im Konsi Bern, um über Talentförderung zu debattieren.

In seinen einführenden Worten beschrieb Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der Präsident der Parlamentarischen Gruppe Musik PGM, den «Musikförderungsartikel», der 2012 angenommen wurde: «Was an Unklarheiten in einen Verfassungsartikel gesteckt werden kann, ist in Art. 67a drin.» Rückenwind aus der Verfassung hatte man sich erhofft, nun reibt man sich bei der Umsetzung musikalischer Förderziele an Unklarheiten, Zuständigkeitsfragen und fehlendem Tempo.
Beim Treffen der PGM ging es im Speziellen um die Talentförderung. Auch da scheinen die Bestrebungen nur schwer vom Fleck zu kommen. Nicht, dass es keine Förderinstrumente für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche gäbe, es gibt viele, Müller-Altermatt hatte sogar den Begriff «Dschungel» in den Veranstaltungstitel eingebracht: «Kampf um Talente – Begabtenförderung im Dschungel der Zuständigkeiten». Der Bericht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation vom Februar 2017 verweist auf eine stattliche Anzahl an kantonalen Massnahmen, kommt aber doch zum Fazit, dass es an den Musikhochschulen einen «teilweise geringen Anteil an Bildungsinländern» habe.
Talente bringen Talente hervor
«Es ist alles gesagt, alles geschrieben, alles wissenschaftlich belegt, was fehlt, ist der politische Wille.» So fasste Hector Herzig in einem Kurzreferat seine Sicht auf die schleppende Umsetzung des Verfassungsartikels und einer zielführenden Begabtenförderung zusammen. «Warum», fragte er weiter, «gibt es kein Musikförderungsgesetz, wo es doch längst ein Sportförderungsgesetz gibt?» Der Bund habe bei den Kantonen drei Lektionen Sport für Kinder und Jugendliche durchgesetzt, da müsse er doch auch im Hinblick auf die musikalische Bildung Einfluss nehmen können.
An der anschliessenden Podiumsdiskussion berichtete Thomas Limacher, Rektor der Musikschule Luzern, über das dortige Fördermodell. Dank einer privaten Zuwendung bestehe im Kanton Luzern seit vier Jahren eine Begabtenförderung Musik. Das Wichtigste dabei sei, die Talente zwar zu unterstützen, sie aber möglichst lange in ihrem angestammten Umfeld zu lassen, denn dort, in der örtlichen Musikgesellschaft oder der regionalen Musikschule, wirkten sie als Leuchttürme. Das eine Talent ziehe in der Regel bald ein zweites, drittes nach sich. Es könne also keineswegs darum gehen, die Talente so schnell wie möglich den regionalen Strukturen zu entziehen und zentral weiter zu fördern. Mit dieser Aussage berührte Limacher ein gesamtgesellschaftliches Thema, das die Musikförderung zusätzlich erschwert und das auch Herzig bereits angesprochen hatte: Die Vereine, das Rückgrat der kulturellen Schweiz, erodieren.
Auf eine paradoxe Situation wies Michael Kaufmann, Direktor der Musikhochschule Luzern, hin: Dieselben politischen Kreise, die bislang keine Talentförderung finanzierten, monierten den niedrigen Anteil von Studierenden mit schweizerischem Zulassungsausweis an den Musikhochschulen. Damit mehr Schweizer Nachwuchsmusikerinnen und -musiker das Hochschulniveau erreichten, brauche es aber eine Talentförderung.
Die Pendenzenliste ist lang
Isabelle Chassot, die Direktorin des Bundesamtes für Kultur, hielt dem entgegen, dass man sich in der Kulturbotschaft 2016–2020 auf die Implementierung des Programms Jugend+Musik konzentriert habe. Die Massnahmen zur Talentförderung müsse man nun für die nächste Periode diskutieren. Da die jetzigen Strukturen sehr unterschiedlich seien, sollte man vielleicht regionale Zentren ins Auge fassen. (In der Tat erwartet der Schweizer Musikrat die Ausarbeitung der Kulturbotschaft 2021–2024 ab Sommer 2018. Deshalb hat er seine Mitglieder aufgerufen, bis am 29. März Vorschläge einzureichen, welche Anliegen der Musiksektor in die Kulturbotschaft einbringen soll.)
Auf die Frage des Moderators Wolfgang Böhler, ob denn der Föderalismus die Bremse sei, entgegnete Susanne Hardmeier, die Generalsekretärin der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK, das Engagement der Verantwortlichen in den Kantonen sei riesig, und die Unterschiede zwischen den Kantonen ein Reichtum, kein Hindernis. Grosse Aktivität auch da, aber keine gemeinsame Lösung in Sicht. Voten aus dem Plenum verlängerten den Katalog der ungelösten Problemkreise: Rainer J. Schweizer betonte, dass Begabtenförderung mit dem Zugang zur Musik beginne und dass die Schweiz bei der Erfassung der Kinder aus bildungsfernen Kreisen weit zurückliege. Und Armon Caviezel fragte im Hinblick auf die Schulmusik, was die EDK tun wolle, um die Lehrpersonen für den Lehrplan 21 im Fach Musik fit zu machen.
Im Windschatten des Interesses
Insgesamt also weit mehr Fragen als Antworten. Nationalrat Müller-Altermatt brachte es auf den Punkt: «Wenn ich jetzt in die Eidgenössischen Räte zurückgehe und ein Musikförderungsgesetz durchbringen möchte, dann wüsste ich nicht, wie man das institutionell lösen sollte. Wo den Hebel ansetzen zwischen Kompetenzen der Kantone und des Bundes?»
Die Grundstimmung des Stillstands trotz zunehmender Dringlichkeit, der Ratlosigkeit und Ermüdung, die sich vielerorts bemerkbar machte, fasste Thomas Limacher ganz handfest: «Wir können im Kanton Luzern mit unserem Förderprogramm noch etwa zwei Jahre so weitermachen, dann reichen die bisherigen, eben privaten Mittel nicht mehr aus. Wenn dann keine Hilfe von der Politik kommt, müssen wir das Programm massiv reduzieren oder aufhören.»
Gerade einmal ein Parlamentarier und eine Parlamentarierin hörten sich diese Anliegen von über dreissig Vertreterinnen und Vertretern der Musikszene an. Offensichtlich hält sich das Interesse der Politik an musikalischen Fragen in Grenzen.