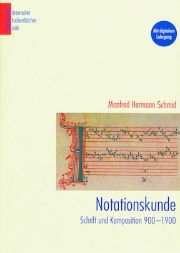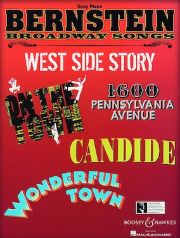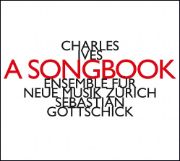Doppelte Auszeichnung für das Trio Rafale aus Zürich
Das Trio Rafale (Klaviertrio) aus Zürich hat am 7. März 2013 in der Tonhalle Zürich anlässlich eines öffentlichen Konzerts die Auszeichnung Migros-Kulturprozent-Ensemble 2013 und gleichzeitig den Publikumspreis gewonnen.

Seit 1974 erleichtert das Migros-Kulturprozent jungen Schweizer Kammermusik-Ensembles den Karrierestart. In diesem Jahr fand das Finale zum zweiten Mal öffentlich statt. Drei Kammermusik-Ensembles haben sich durch ein Vorspiel am 19. Februar 2013 für das Finale vom 7. März 2013 in der Tonhalle Zürich qualifiziert: das Belenus Quartett (Streichquartett) aus Zürich, das Daimones Piano Trio (Klaviertrio) aus Basel und das Trio Rafale (Klaviertrio) aus Zürich. Die drei Ensembles bewiesen ihr Können je mit einem halbstündigen Auftritt auf höchstem Niveau. Eine hochkarätige internationale Jury wählte das Trio Rafale als Preisträger-Ensemble 2013, das gleichzeitig auch den Publikumspreis erhielt.
Das Trio Rafale, bestehend aus Maki Wiederkehr (Klavier) und Flurin Cuonz (Violoncello) – beides Migros-Kulturprozent Studienpreisträger 2009 und 2010 – sowie Daniel Meller (Violine), vermochte die Jury und das Publikum mit seiner Darbietung von Ravels Trio in a-Moll gleichermassen zu begeistern. Das Migros-Kulturprozent-Ensemble 2013 erhält ein Preisgeld von 10 ‚000 Franken sowie eine umfassende Förderung, die es dem Ensemble erlaubt, Konzerterfahrung zu sammeln und nationales Renommee zu erlangen. Alle drei Finalisten-Ensembles werden in die Konzertvermittlung des Migros-Kulturprozents aufgenommen, die einen finanziellen Beitrag an das Engagement der Ensembles leistet. Konzertveranstalter können auf diese Weise zu guten Konditionen anspruchsvolle Konzerte mit Schweizer Musiktalenten anbieten.
Der Jury des Finales vom 7. März 2013 gehörten an:
- Reinhold Friedrich, Trompete, internationale Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker
- Ulrich Koella, Professor für Klavierkammermusik an der Zürcher Hochschule der Künste,internationale Konzerttätigkeit als Kammermusiker und Begleiter
- Patricia Kopatchinskaja, Violine, internationale Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin
- Patrick Peikert, Direktor von Claves Records und des Concours Clara Haskil,Gründer der Konzertagentur Applausus
- Christian Poltéra, Violoncello, internationale Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker
Das Migros-Kulturprozent
Das Migros-Kulturprozent fördert seit 1969 Schweizer Nachwuchskünstlerinnen und -künstler im Rahmen national ausgerichteter Talentwettbewerbe sowie von Studien- und Förderpreisen. Die Studienpreise ermöglichen den Nachwuchstalenten, ihre Ausbildung im In- und Ausland zu finanzieren. Die Studienpreise sind mit je 14 400 Franken dotiert. Ausserordentlich begabte Studienpreisträgerinnen und -preisträger erhalten Förderpreise. Diese beinhalten langfristig ausgerichtete, individuelle Fördermassnahmen wie Auftrittsmöglichkeiten, Coachings und Promotion. Die Wettbewerbe finden jährlich in folgenden Sparten statt: Bewegungstheater, Gesang, Instrumentalmusik, Kammermusik (biennal), Schauspiel und Tanz.
Rund 2800 vielversprechende Talente wurden bis anhin mit insgesamt 37 Millionen Franken unterstützt und auf dem Weg von der Ausbildung in den Beruf mit umfassenden Fördermassnahmen begleitet. Das Migros-Kulturprozent stellt auf seiner Online-Talentplattform herausragende Talente mit ihrer Biografie sowie mit Bild und Tonbeispielen vor. Kulturveranstalter, Kulturschaffende und Künstleragenturen können so einfach und unkompliziert Nachwuchstalente entdecken.
Talentwettbewerbe: www.migros-kulturprozent.ch/talentwettbewerbe
Online-Talentplattform: www.migros-kulturprozent.ch/talente