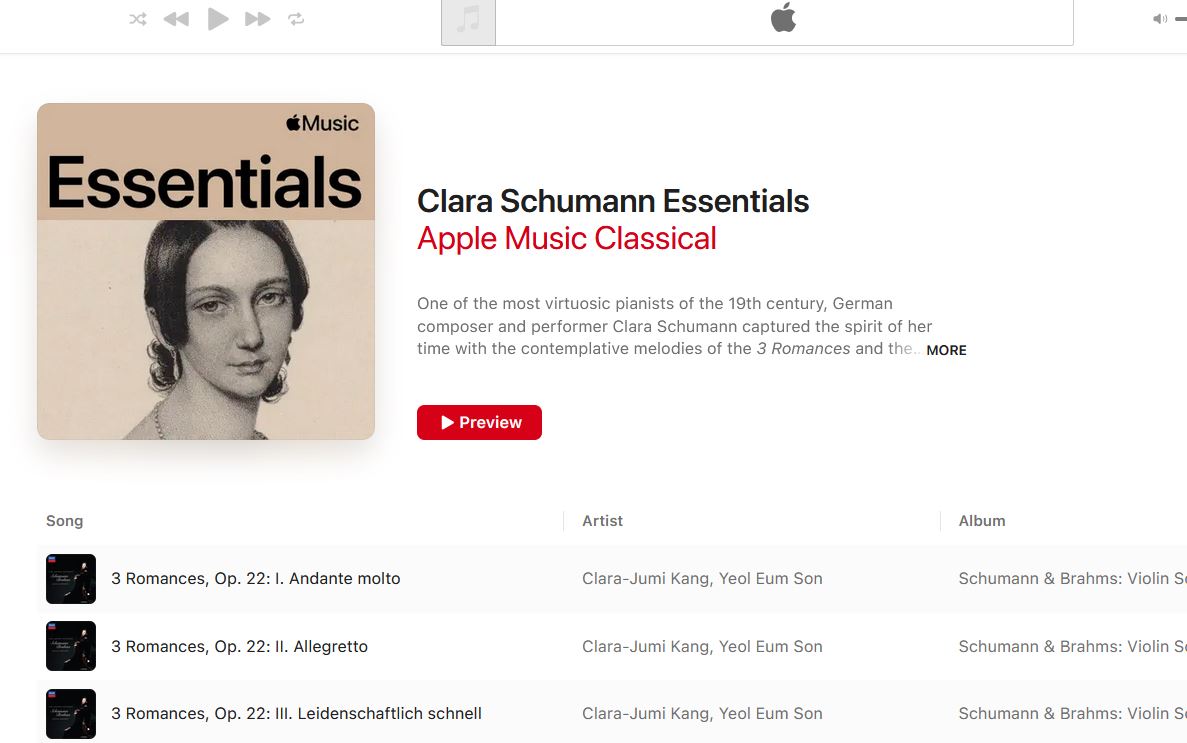Suisseculture kritisiert Kürzungen der Kulturausgaben
Suisseculture, der Dachverband der Schweizer Kulturschaffenden, kritisiert vom Bundesrat geplante massive Kürzungen des Kulturbudgets scharf. Damit verunmögliche der Bund, die Herausforderungen nach der Pandemie angehen zu können.

Was in der Medienmitteilung des Bundesrates als «temporärer Rückgang» des Wachstums bezeichnet werde, schreibt Suisseculture, bedeute in Zahlen für das Jahr 2024 Kürzungen des Budgets um zwei Prozent. Kürzungen, welche die Kultur im schlechtmöglichsten Zeitpunkt treffen würden. Die vorgegebene Obergrenze für das Zielwachstum der Finanzbeschlüsse für die Jahre 2025 bis 2028 werde im Bereich Kultur vom Bundesrat auf 1,2 Prozent festgesetzt. Das Zielwachstum gleiche damit die Kürzungen von 2024 bei Weitem nicht aus. So könnten weder die Herausforderungen für den Kulturbereich in Angriff genommen noch die Teuerung kompensiert werden.
Zu einem Zeitpunkt, da über einen Teuerungsausgleich von mehreren Prozenten auf die Lohnsumme verhandelt werde, sei eine Kürzung der Kulturausgaben (die zum allergrössten Teil direkt in Lohnzahlungen fliessen) nicht vertretbar. Vielmehr sei es an der Zeit, nachhaltige Massnahmen zur Verbesserung der sozialen Sicherheit für Kulturschaffende einzuleiten – mit entsprechenden Anpassungen in den Vorsorgesystemen der ersten und zweiten Säule.
Originalartikel:
https://www.suisseculture.ch/?article=der_bundesrat_verkauft_kuerzungen_als_wachstum