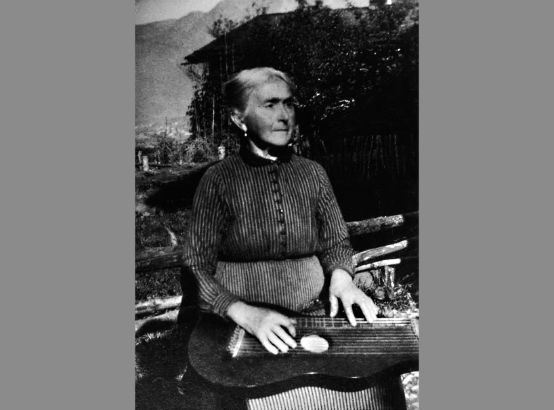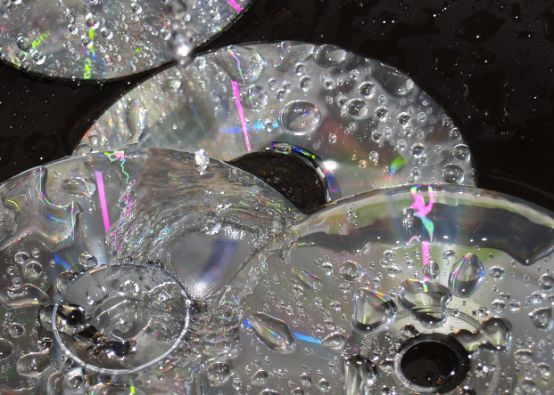«Ich dachte immer, ich muss mich mehr anstrengen»
Wie ein Handprofil die Wahrnehmung verändert. Ein Fallbeispiel.
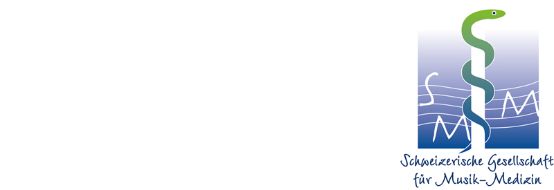
Angesichts der enormen Individualität der menschlichen Hand mit Unterschieden von über 9 cm bei der Spannweite 2-5 (zwischen Zeigefinger und kleinem Finger) und bis zu 7 cm bei der Spannweite 3-4 (zwischen Mittelfinger und Ringfinger) kommt es für einen ersten Eindruck von Spielräumen und Grenzen einer Musikerhand kaum auf eine millimetergenaue Messung an. Schon die Pragmatische Handeinschätzung (PHE) des Musikphysiologie-Pioniers Christoph Wagner kann helfen, Ursachen von übermässiger Ermüdung und Overuse-Syndromen auf die Spur zu kommen. Die PHE, die «kleine Schwester» der von Wagner entwickelten und seit 2009 am Zürcher Zentrum Musikerhand der ZHdK beheimateten Biomechanischen Handmessung (BHM), erfasst die Handgrösse, alle Daumen- und Binnenspannweiten und zehn weitere Handeigenschaften. Anhand der Messblätter aus Wagners Buch Hand und Instrument werden individuelle Werte mit denen von Profimusikern verglichen.
Der Individualität der Hand steht die genormte Klaviatur gegenüber − und der Traum vieler Pianisten, sich auch jene Perlen der Klavierliteratur zu erschliessen, deren spieltechnische Anforderungen womöglich die eigenen Grenzen übersteigen. Für eine 53-jährige Klavierpädagogin war das Spielen auf dem modernen Flügel «immer mit Krampf verbunden. Was mir immer Schwierigkeiten gemacht hat, ist Akkordspiel.» Ganz anders ihr Spielgefühl, als sie im Alter von 47 Jahren erstmals Hammerflügel spielte: «Da war das Gefühl: das ist mein Instrument. Ich konnte fliessender spielen.»
Das Handprofil der spieltechnisch versierten Pianistin zeigt eher geringe Daumen- und Binnenspannweiten trotz eher grosser Hände. Deutlich begrenzt war die Spannweite 2-4. Zudem konnte sie ihren rechten Daumen nur auf maximal 65 Grad abspreizen. Als die Klavierpädagogin nach der PHE noch einmal schwie-rigen Stellen am modernen Flügel nachspürte, stellte sie verblüfft fest: «Es sind tatsächlich alle Stellen, die eine Binnenspannung erfordern, die immer einen Mehraufwand bedeutet haben.» Ganz extrem war eine Allegro-assai-Stelle aus Mendelssohns Trio op. 49. «Die habe ich eigentlich nie wirklich gekonnt.» – Vermutlich wegen der fast gleichzeitig geforderten Quinte mit Zeige- und Ringfinger und Septime mit Zeigefinger und kleinem Finger.
Im Rückblick auf ihre Studienzeit resümiert die Klavierpädagogin: «Mir wurde gesagt, dass ich eine grosse Hand und schnelle Finger habe. Wenn ich gewusst hätte, dass es diese Spannweiten sind, dann hätte ich zum Beispiel ganz andere Stücke gespielt. Ich dachte immer, ich muss mich mehr anstrengen. Mein Lehrer sagte zu mir: ‹Sie müssen nur wollen.›» Und sie fährt fort: «Wenn mir das früher klar gewesen wäre, hätte sich vor allem mein Umgang mit mir selbst und meinen Übemethoden geändert. Von den Stücken her habe ich mich zwar schon relativ bald nach dem Studium an kleingriffiger Literatur orientiert, aber immer mit einem leisen Groll mir selbst gegenüber, nicht die ‹richtige› Technik zu haben, um Chopin-Balladen oder Brahms spielen zu können.»
In diesen Aussagen wird mehreres deutlich: Die durchaus sensible Wahrnehmung der eigenen biomechanischen Grenzen schon im Studium, das zwischenzeitlich verlorengegangene Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, das mangelnde Einfühlungsvermögen des Lehrers, die Orientierung an einer Repertoire-Norm und an Anstrengung …, die wiedergewonnene Wahrnehmung, schon durch das veränderte Spielgefühl am Hammerflügel und weiter durch den objektiven Vergleich − und die seelische Erleichterung durch das Wissen um die individuellen biomechanischen Gegebenheiten.