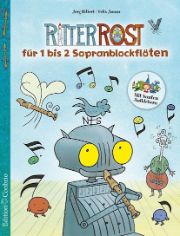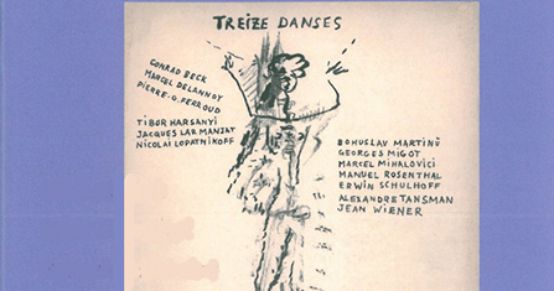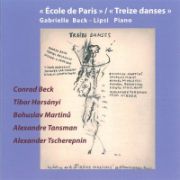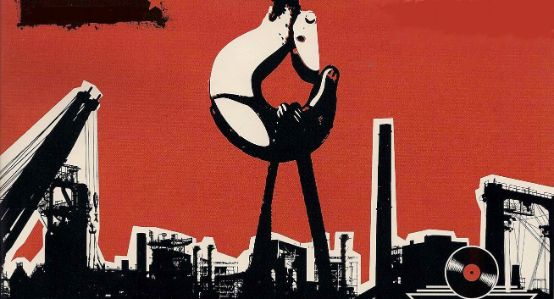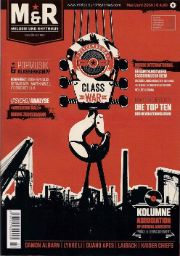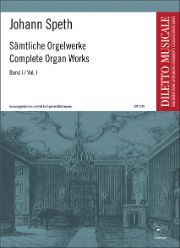Die Musik ist ein uralter Weg, die Resonanzfähigkeit des Menschen zu schulen. Schon in frühen Zeiten in Tibet, Ägypten und im antiken Griechenland wurde Musik zur Heilung eingesetzt. Klänge wirken unmittelbar über das Ohr (und dessen Nervenverbindungen zum Gehirn) auf den gesamten Organismus. – In der klinischen Psychologie gibt es den Satz: «Jede Krankheit hat eine zerebrale Dominanz». Das Gehirn ist die Koordinationszentrale des ganzen Körpers. – Novalis schreibt über die Heilkraft der Musik: «Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, die Heilung eine musikalische Auflösung».1
Die Beziehung von Energien zwischen Musik und Körper
Heutige wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen zunehmend, was in früheren Kulturepochen der Menschheit als intuitives Wissen gelebt und gelehrt wurde. Es wird klar, dass alle Lebensprozesse miteinander vernetzt sind und durch eine einheitliche Grundlage, die früher ätherische Energie hiess und heute Lebensenergie genannt wird, miteinander verwandt sind und im Austausch stehen. Jedes System kann aus diesem Grunde mit einem anderen kommunizieren. Aus dieser Sachlage heraus wird auch vieles deutlicher, was die Musik mit dem Menschen gemeinsam haben kann. War dies vorher ein Interesse der Philosophie und der Ästhetik, so wird es zunehmend nun zum Interesse der Wissenschaft.
Die Macht und Magie, die ungeheure Energetik der Musik, die Massen bewegen kann, wird zum wissenschaftlichen Forschungsfeld. Vor allem wird natürlich nach therapeutischen neuen Möglichkeiten gesucht, aber nicht zuletzt auch nach neuen Potenzialen der Macht, was sich deutlich in Musikmarkt und Werbung zeigt. Aber auch Prediger neuer Religionen in Amerika haben die Macht der Musik als Instrument des kollektiven Zusammenschweissens neu entdeckt.
Umso wichtiger erscheint es deshalb gerade auch für die Musiker, einzudringen in die energetische Welt der Musik, um die Verantwortung zu übernehmen für solch ein machtvolles Instrument. Theoretisch gab es in jüngerer Vergangenheit sehr gute und neue Ansätze zum Verständnis des inneren Wesens der Musik, vor allem aus den Reihen der Anthroposophen. Wertvolle Erkenntnisse verdanken wir diesen Musikern und Forschern, die ihre Anregungen meist aus der Beschäftigung mit früheren Kulturepochen schöpften.
Die moderne Gehirnforschung deckt auf, dass alle Prozesse in unserem Körper, auch die biochemischen, von unseren Gedanken, Gefühlen und Vorstellungen bestimmt und durch Bewusstsein beeinflusst werden. Es gibt keine Getrenntheiten. Geist und Körper sind eins. Im Körper finden wir eine Vereinigung von verschiedenen Bewusstseinsebenen. Alle Erscheinungen des Kosmos werden durch die ihn stetig durchflutenden Energieinformationsfelder durchdrungen. Durch diese konstante, präsente Energie, auch Äther genannt, sind alle Wesen miteinander verbunden und in Kontakt.
Die Selbstheilungskräfte aktivieren
Jedes Leben entsteht durch einen Prozess der Selbsterschaffung und organisiert sich selbst. Indem wir sie leben, erschaffen wir unsere eigene Welt. Wie wir Welt erleben, auch in unserem körperlichen Sein, hängt davon ab, auf welche Weise wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben, Welt sinnlich wahrzunehmen. Wie wir Wirklichkeit und Welt wahrnehmen, ist also ein empirischer Vorgang.
Unser Gehirn besteht aus drei Typen, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben. Der älteste Typus wird als Reptilhirn oder Reptilkomplex bezeichnet, der gefolgt wird vom Limbischen System, das den niederen Säugetieren entspricht. Diese beiden Gehirntypen steuern unser Hauptprogramm Genetik. Unser Programm Vernunft wird als Nebenprogramm bezeichnet, ist relativ jung in seiner Entwicklung und hat seinen Sitz in der Grosshirnrinde (Cortex). Allen drei Gehirntypen wird eigene Intelligenz, Subjektivität und eigenes Gedächtnis zugesprochen.
Die Angewandte Musikheilkunst zielt nun darauf ab, diejenigen Gehirnareale zu aktivieren und miteinander zu vernetzen, welche zuständig sind für die Selbstheilung. Genau diese Areale sind es auch, in welchen sich der Sitz unserer Kreativität befindet. Die heilsame Wirkung der Musik kann gezielt genutzt werden, indem man individualisierte Musikprogramme zum aktiven Hören und zur gleichzeitigen Stressablösung zusammenstellt, die vier- bis achtmal wirksamer sind als ein herkömmliches Medikament – wie die Stresskonferenz der Weltgesundheitskonferenz aufzeigte.
Wenn wir die Strukturelemente und die heilenden Dimensionen in der Musik untersuchen, entdecken wir die Dreiheit des Lebensprinzips: nämlich den Lebensrhythmus, die Lebensmelodie und die Lebensharmonie. Oder wie sich etwa Ludwig van Beethoven dazu geäussert hat: «Musik vermittelt zwischen der Geistes- und der Sinneswelt.»
Da wir als Personen (personare = hindurchtönen) unsere Fähigkeit zur Resonanz verfeinern können, indem wir unsere Sinne schulen, öffnen wir die Wahrnehmung für die heilenden Qualitäten der Musik. Wenn wir dabei all unsere Sinne bewusst einsetzen, wird unser Leben sinnvoll.
Angewandte Musikheilkunst
Das neu erarbeitete Konzept der Angewandten Musikheilkunst von Wenzel Grund basiert auf seinem reichen Erfahrungsschatz als Musik-Kinesiologie-Ausbildner, Musiker, Pädagoge und Therapeut. Seit vielen Jahren praktiziert und unterrichtet er erfolgreich die Musik-Kinesiologie als Ganzheitsmethode für den stressfreien und kreativen Umgang mit dem Musikerberuf. Daraus entwickelte er neue, sofort umsetzbare Möglichkeiten, die heilsame Wirkung der Musik zu erfahren und gezielt anzuwenden.
Die neue Ausbildungsreihe zur Angewandten Musikheilkunst wird am kinesiologischen Institut IAK in Kirchzarten bei Freiburg i. B. angeboten (www.iak-freiburg.de).
Die Seminare eignen sich für Musikpädagogen, Bühnenkünstler, Therapeuten sowie alle musikliebenden Menschen, die eine entsprechende Weiterbildung, Wissensvertiefung und Horizonterweiterung erfahren oder sich ein spannendes neues Berufsfeld. erschliessen wollen.
1 Nachweis Zitat: Novalis Schriften, herausgegeben von Ludwig Tieck und Fr. Schlegel, Fünfte Auflage, Zweither Theil, Berlin Verlag von G. Reimer, 1837, Seite 168 (Fragmente vermischten Inhaltes, I Philosophie und Physik).