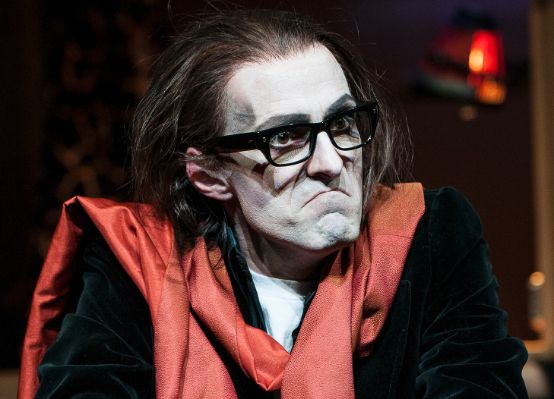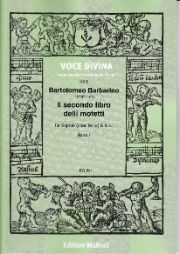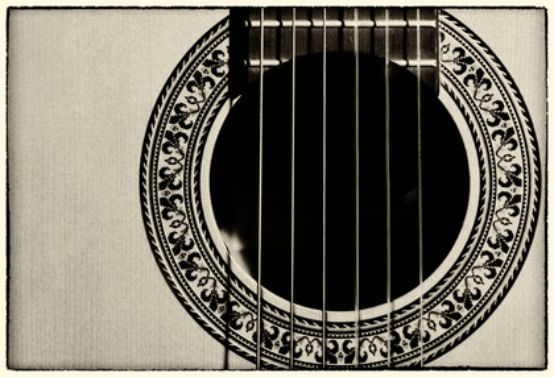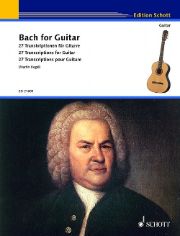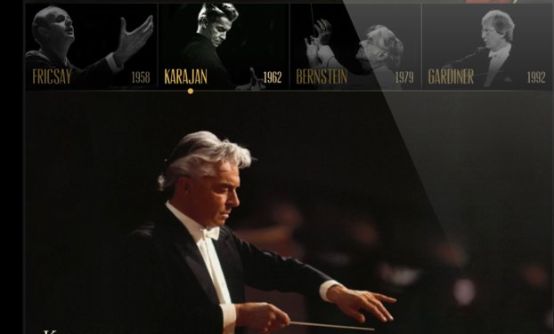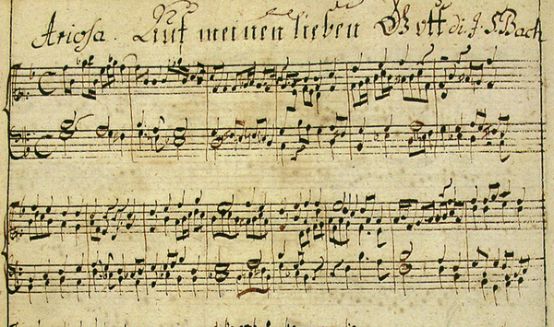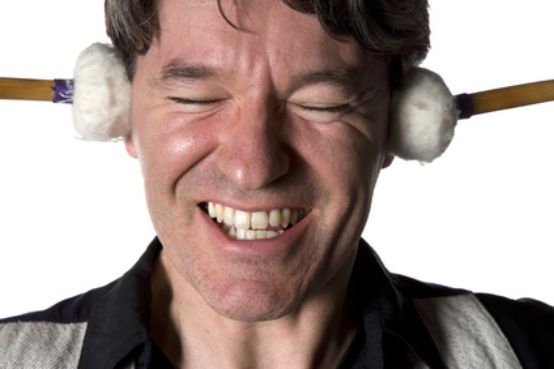Angesichts stetig sinkender Tonträgereinnahmen hat das Live-Geschäft für Musiker an Bedeutung gewonnen. Doch von Konzerten in der Heimat kann kein Schweizer Popmusiker leben. Folgerichtig wurde deshalb am M4Music an zwei Panels diskutiert, ob der Standort Berlin für sie zum Sprungbrett für eine internationale Karriere werden kann.
Berlin hat Sogwirkung, wie Katja Lucker, Musikbeauftragte des Landes Berlin, weiss. Auch die Norddeutsche ist eine Zugezogene. «Berlin ist eine unglaublich vielfältige Stadt, in der man noch zu Preisen leben kann, die okay sind», sagte Lucker im Einleitungsgespräch zum m4music-Panel Berlin – Die neue Schweizer Musikhauptstadt?
Ueli Häfliger, Musikchef bei FluxFM, erklärte, er habe sich vor vielen Jahren vorgenommen, mal Musikchef einer Berliner Radiostation zu werden. «Für diesen Traum bin ich dann ausgewandert.» Auch wenn das für ihn bedeutete, sich über einen längeren Zeitraum mit Nebenjobs über Wasser zu halten. Und was war nötig, damit er seine Ambition verwirklichen konnte? «Viel Drive», so der Zentralschweizer.
Auch Tobias Jundt, Sänger des Kollektivs Bonaparte, pries die Vorzüge der deutschen Hauptstadt: «In Berlin kann man international tätig sein, ohne den Ort je zu verlassen.» Aber natürlich müsse man sich bemühen, seinen Platz in der Metropole zu finden. Jundts Methode: Er streifte durch Berlin, auf der Suche nach einem Ort, der ihm zusagte. Gesagt, getan – und spontan am favorisierten Haus geklingelt. Und zwar mit Erfolg: Der Berner erhielt einen Mietvertrag.
Im Gegensatz zu Tobias Jundt vermag Eveline Fink, DJ und Co-Founderin von Enough Music, noch nicht ganz von ihrer Musikbusiness-Tätigkeit zu leben. «Mich hat die Leichtigkeit der Stadt gepackt», schwärmt sie, gibt aber auch zu, dass sie zu Beginn ihrer Berlin-Zeit doch erhebliche Mühe mit dem rauen Umgangston der Einwohner hatte. «Schön, dass Berlin ganz schön hässlich sein kann», ergänzte Tobias Jundt.
Jazzmusiker Stefan Rusconi nannte einen ganz einfachen Grund für seinen Umzug nach Berlin: «Mir hat es in Zürich nicht mehr so gepasst.» Deshalb lebt er nun in der deutschen Hauptstadt, geht – zur Inspiration – viel spazieren und hat sich sein eigenes Studio aufgebaut. Doch längst nicht alle tun sich so – verhältnismässig – leicht. Katja Lucker betonte denn auch: «Berlin ist nicht zuletzt eine Bühne des Scheiterns.» Viele kommen in die Stadt, Erfolg haben nur die wenigsten.
Neue Exportstrategien
Kurz bevor der international bekannte Musikmanager Tim Renner Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin wurde, nahm er an mehreren Panelgesprächen teil, etwa zum Thema Exportstrategien für Indie-Labels, Artist-Managements und DIY-Bands. Als Vertreter der Jury, die den Preis für die Labelförderung von Migros-Kulturprozent vergab, sagte Renner: «Ein Label sollte immer über eine klar erkennbare Identität verfügen.» Ausserdem habe die Jury darauf geachtet, ob ein Label in seiner Arbeit den Medienwandel reflektiere und ob so etwas wie eine Exportstrategie erkennbar sei.
Oliver Jmfeld von YES Music, seit 1989 Manager von DJ Bobo, erzählte von den Anfängen seines Unternehmens und davon, wie er und sein Klient zunächst unter britischer Musikflagge gesegelt seien. «Damals wie heute wartet niemand auf eine Band oder ein Label aus der Schweiz.» DJ Bobo hätte vor zehn Jahren noch 70% seines Umsatzes via Tonträger generiert, heute würden diese bloss noch 10% ausmachen. «Der Rest setzt sich aus Konzerteinnahmen, der Marke DJ Bobo und Nebengeschäften zusammen.»
Auf die Frage von Moderator Jean Zuber, Managing Director von Swiss Music Export, was junge Labels bieten müssten, um sich im Markt zu behaupten, sagten sowohl Jmfeld wie auch René Renner, Director von Metropolis Artist Management: «Sie müssen über einen sehr langen Atem verfügen.»
Das 18. M4Music wird vom 26. bis zum 28. März 2015 durchgeführt.
www.m4music.ch
Der erste Teil des Berichtes über m4music von Markus Ganz wurde in der Schweizer Musikzeitung 5/2014 gedruckt, ebenso sein Kommentar zum Urheberrecht.