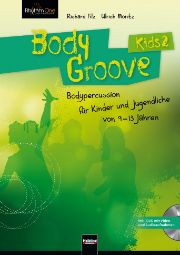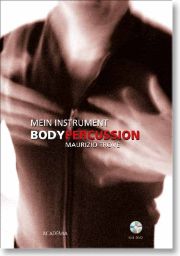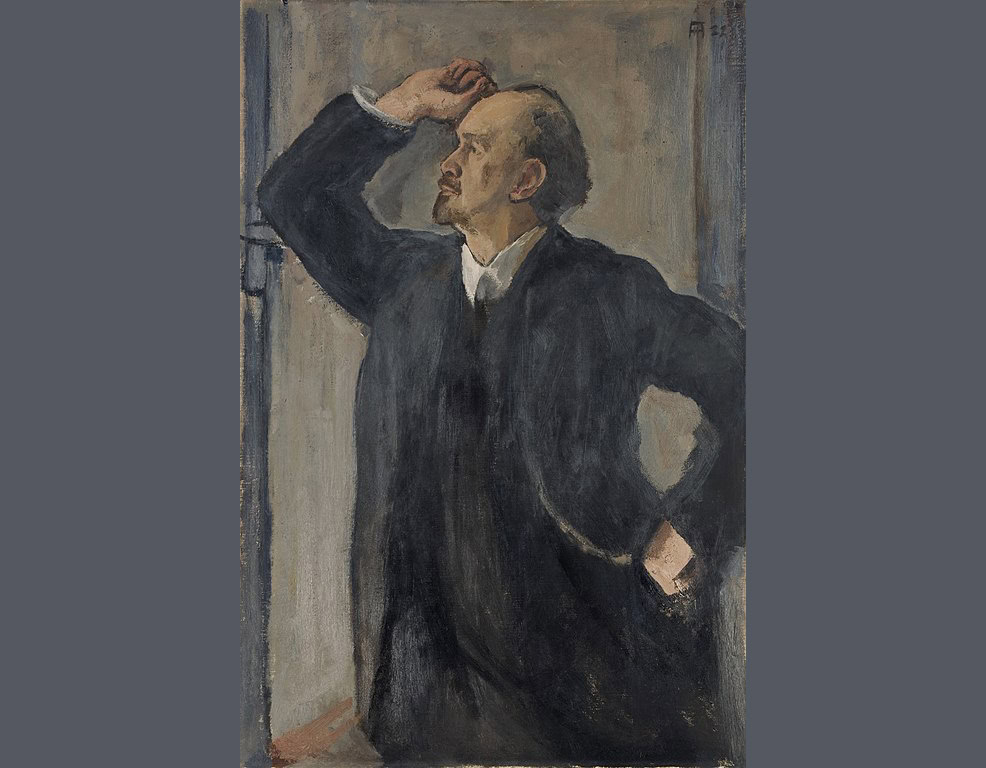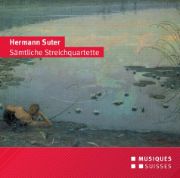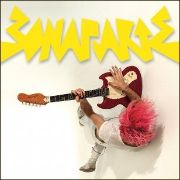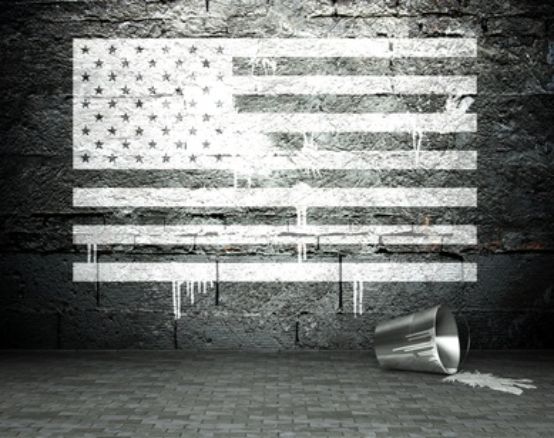Das «Schlagzeug» immer dabei
Zwei neue Bücher leiten an zur Bodypercussion. Das erste ebnet den Einstieg eher für (nicht zu kleine!) Kinder, das zweite für Jugendliche und Erwachsene.

Schnipsen, patschen, schlagen, stampfen, Hände reiben, klatschen. Auf und mit dem eigenen Körper. Das nennt sich Bodypercussion und ist in den letzten Jahren en vogue in der Schulmusik – gleich auf welcher Stufe, ob im Kindergarten oder in der Primar- und Sekundarschule. Es ist insofern eine einfache Sache, weil ohne Voraussetzungen zu erlernen und im Resultat motivierend für die Schülerinnen und Schüler. «Einfach» auch in dem Sinne, dass das Instrument, der Körper, immer mit dabei ist. Die Bodypercussion-Patterns hingegen können schon komplex sein. Mehrstimmige Arrangements mit vertrackten Bewegungsabläufen, das müssen zuerst auch die Lehrpersonen üben, bevor sie eine Gruppe zum Grooven bringen. Andererseits: Rhythmusunterricht kann auf einfachem Niveau beginnen und doch schnell zu Erfolgserlebnissen führen. Und es entspricht dem kindlichen und jugendlichen Bewegungsbedürfnis.
Am Anfang von BodyGroove stehen Warm-ups, einfach und schwungvoll. Up and down and left and right – let’s clap the same speed. Grundlegend ist und bleibt der Puls. Erst wenn der von alleine läuft, kommen Rhythmen dazu, bis der ganze Körper zum Schlagzeug wird. Als nächster Schritt folgen Melodien und Texte, die ihrerseits die Rhythmen stützen und illustrieren. Hier zeigt sich die Nähe der Bodypercussion zum Rap und zum Beatboxen. Die Texte der Arrangements dürften etwas anspruchsvoller, interessanter sein: «Das ist mein Stuhl, ja das ist mein Stuhl» – das wirkt etwas bieder, etwas aufgeräumt.
Vormachen – Nachmachen, das ist hier die natürlichste Lehrmethode. Aber nicht nur. Die «Tipps zu Erarbeitung» bringen Hinweise, wie dieses Muster variiert und erweitert werden könnte. Zum Beispiel kann auch mal ein Schüler Spielleiter sein. Oder die Schülerinnen und Schüler erfinden eigene Bodypercussion-Patterns. Die Aufführungsstücke, die wie die Kreisspiele, Kanons und Rhythmicals auf der DVD vorgestellt werden, zeigen, wie mans machen könnte. Dabei wird eine grosse Klangvielfalt sichtbar, die nur schon durch die verschiedenen Klatschtechniken entstehen. Let us play the Groove!
Von «einfach» über «mittel» bis «anspruchsvoll»: Das Buch von Maurizio Trové ist didaktisch geradlinig aufgebaut. Im ersten Teil werden die binären und ternären Rhythmen eingeführt sowie rhythmische Grundmuster und Klatschkombinationen vorgestellt. Grundpuls in den Füssen, Rhythmen in den Händen, Akzentuierungen, Klangerweiterungen durch verschiedene Schlagtechniken, Taktverschiebungen, Kombinationen aus 8er-, 6er- und 4er-Rhythmen, Polyrhythmik. Die Übungen werden laufend komplexer und anspruchsvoller. Gehirnhälften trainieren! Kopf, Hände und Füsse sind gleichermassen gefordert. Üben ist also angesagt – aber nicht nur: Die «Gruppenspiele» sorgen für Auflockerung und öffnen den Raum fürs Improvisieren und Interagieren. Das macht Spass, relax! Doch jetzt fängts erst richtig an. Die Klatschrhythmen werden auf dem Körper verteilt, es ertönen Brust-, Oberschenkel- und Wangenschläge, und durch die Vielfalt der Geräusche entsteht ein lebendiger Rhythmus, der zum Tanzen auffordert. Die Videoclips zeigen dies anschaulich und prägnant. Allerdings könnten sie etwas länger sein, damit der Leser die Möglichkeit erhielte, die Rhythmen zusammen mit den Clips zu üben. Eine Loopfunktion, die die Patterns endlos wiederholt, wäre hilfreich. Ebenso fehlt das Einzählen, damit man richtig startet.
Die Latin Grooves und die Pop/Rock Grooves im dritten Teil sind so arrangiert, dass sie gut zum Klassenmusizieren passen oder Chorstücke rhythmisch-perkussiv begleiten können. Hier und in den Arrangements des zweiten Teils zeigt sich, was Bodypercussion vermag: Mit Schwung und Fantasie die Klänge des eigenen Körpers entdecken. Dazu liefert das Buch vielerlei Anregungen.
Richard Filz und Ulrich Moritz, BodyGroove, Bodypercussion für Kinder und Jugendliche von 9-13 Jahren, HI-S6903, mit DVD (Video und Audio), Fr. 38.90, Helbling, Bern u.a. 2013, ISBN 978-3-86227-102-3
Maurizio Trové, Bodypercussion – Mein Instrument, 111 S., mit DVD, € 28.50, Academia-Verlag, St. Augustin 2014, ISBN 978-3-89665-627-8