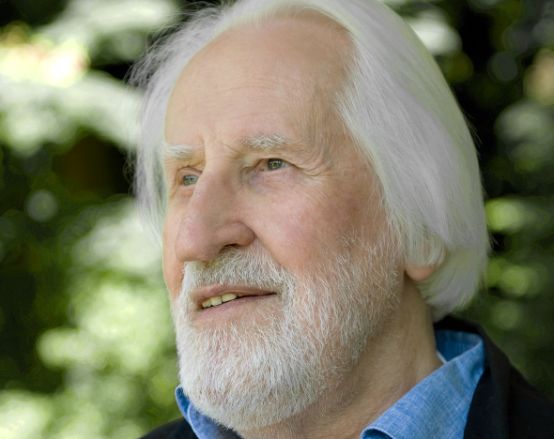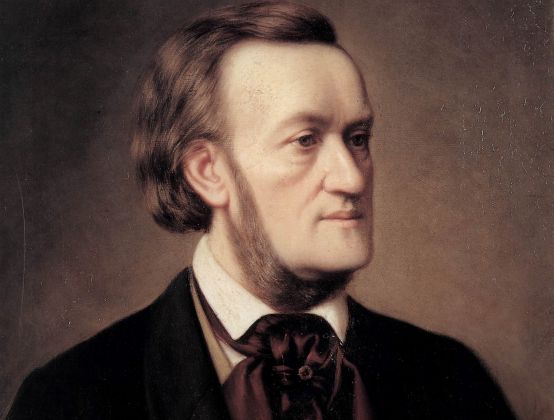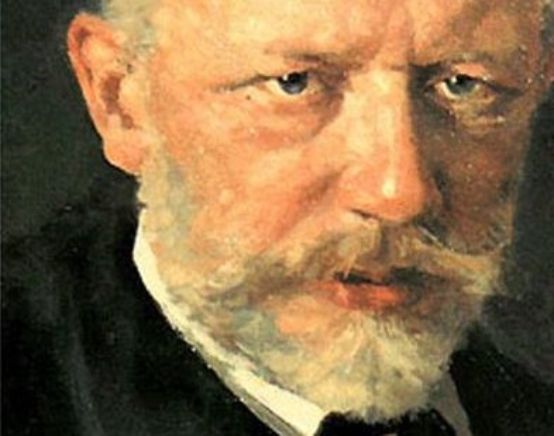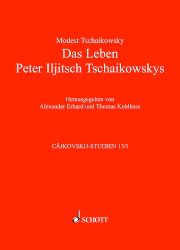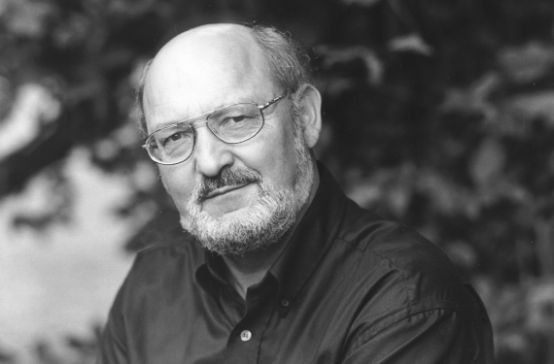Die Popmusikerin Heidi Happy und der Blueser Christian «Blind Banjo» Aregger gehören zu den Gewinnern eines Aufenthaltes im Wohnatelier Chicago von Stadt und Kanton Luzern. Die Belegung des Ateliers für die Jahre 2014 und 2015 ist Anfang dieses Jahres ausgeschrieben worden.
Während ihres Atelieraufenthaltes will Heidi Happy (Priska Zemp) komponieren und ein neues Album schaffen. Die Jury «ist gespannt, wie sich die Einflüsse und der Rhythmus der Grossstadt auf ihr Schaffen auswirken und sich in ihrem Album widerspiegeln werden». Christian Aregger wiederum erhält «die Möglichkeit, in die Stadt des Blues – back to Mama – einzutauchen und die Wurzeln zu suchen».
Berücksichtigt worden sind zudem die Beweberbungen der Textildesignerin und Ausstatterin Nina Steinemann, des Filmemachers und Fotografs Ralph Kühne, des Illustrators Benedikt Notter und der Kuratorin Nadine Wietlisbach.
Vergeben worden sind je viermonatige Atelieraufenthalte. Dafür beworben haben sich insgesamt 43 Kulturschaffende. Die Jury: Sandra Baumeler (Verein Städtepartnerschaft Luzern–Chicago), Benji Gross, (FUKA-Fonds Stadt Luzern), Nathalie Unternährer (Leiterin Kulturförderung Kanton Luzern), Verena Omlin (Kulturförderung Stadt Luzern) und Stefan Sägesser (kantonale Kulturförderungskommission).