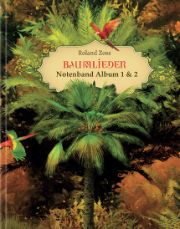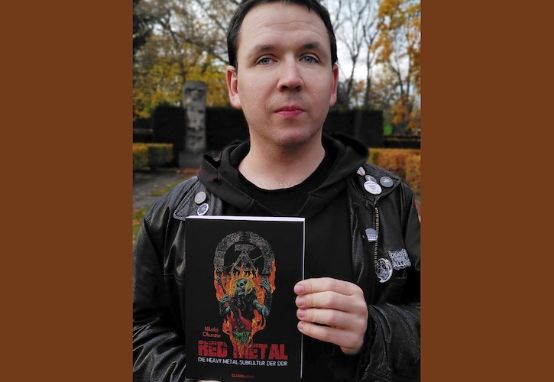Klingende Bäume
Das Notenbuch zu den Baumliedern von Roland Zoss erlaubt die eigene Gestaltung. Einfach zuhören kann man mit den beiden CDs «Bäume des Nordens» und «Bäume des Südens».

Der Schweizer Singer-Songwriter Roland Zoss hat sich aufgemacht, Bäume zu vertonen. Ganze 28 Baumlieder hat er geschrieben, jedes auf der Suche nach der klimatischen, mythologischen und morphologischen Eigenheit eines Baumes – und seiner Bedeutung für uns Menschen. Als Erstes kommt der Mammutbaum, denn er ist der älteste von allen. Er wird 3000 Jahre alt und ist bis 120 Meter hoch. Oft treffen ihn Blitze, aber die entstehenden Waldbrände überlebt er dennoch. Den indianischen Ureinwohnern gilt er als heilig.
Wer jetzt, bei so vielen Bäumen, einen hölzernen Sound vermutet, liegt falsch. Die Musik ist rockig, groovig und lädt ein zum Mitsingen oder Selber-Gestalten. Dank dem Notenbuch oder dem Textbuch und den beiden CDs Bäume des Nordens und Bäume des Südens ist das auch möglich. 27 Musiker und Sängerinnen hat Zoss dafür aufgeboten, darunter grosse Namen wie Corin Curschellas oder Markus Flückiger. Die Lieder erklingen, je nach instrumentaler Zusammensetzung, in verschiedenfarbigen Gewändern. Die melancholische Duduk umspielt den Olivenbaum (seit 10 000 Jahren nachweisbar) und das Trümpi leitet das Lied zum Karube-Baum ein. Der Karube ist der Johannisbrotbaum aus Ägypten, und ja, der Name geht auf Johannes den Täufer zurück. Der Baum lieferte das Mass für das Wägen von Gold: 24 Karubensamen wiegen 24 Karat Gold. Heute kommt Karubenmehl als E 410 in Babynahrung und Tabletten vor. Man lernt viel über die Bäume in diesen Liedern.
Zoss ist Baumspezialist. Er umarmt sie, hört ihnen zu und kennt ihre Geschichte. «Du kämpfisch für d Natur, u we der Muet di mal verlaht, chum gang u hol dir d Chraft – us em Karubeboum!» – diese Refrainzeile ist typisch für die Baumlieder. Das Baumliederbuch ist nicht nur eine Ode an die Bäume, sondern Kraftquelle für unseren Kampf für die Natur.
Gehaltvolle Texte, schöne Melodien, farbig begleitet: geglückte CDs! Und ein Notenbuch (als E-Book), das weit über die Wiedergabe der Melodien hinausgeht. Offen bleibt nur der Wunsch nach einer Playback-Version zum Mitsingen.
Roland Zoss: Baumlieder. Notenband Album 1 & 2: 28 Notenblätter, Songtexte und Infos in Berner Mundart, E-Book, 89 S., Fr. 20.00, ISBN 978-1-09830-676-2; Textbuch: 27 Songtexte & Bauminfos, Fr. 4.00;
CD 1: Bäume des Nordens;
CD 2: Bäume des Südens, je Fr. 20.00;
www.baumlieder.ch