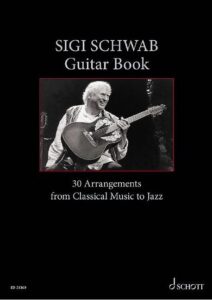Cello allein und zu zweit
Kompositionen von Roland Moser, gespielt von seiner Partnerin Käthi Gohl Moser ergeben eine unprätentiöse, «atmende» CD.

Wann habe ich zuletzt eine derart intime Musik gehört?! Das liebevolle Miteinander ist gleichsam die Voraussetzung für die meisten Stücke auf dieser CD, denn der Komponist komponiert hier häufig für die Cellistin, mit der er schon seit Langem das Leben teilt, Roland Moser schreibt für Käthi Gohl Moser.
Das allerdings hat nichts Repräsentatives oder Repräsentabel-sein-Wollendes an sich, kein Klangfotoalbum. Vielmehr gewähren uns da zwei Einblick, Einhorch in ihren musikalischen Dialog. Gern zweistimmig, wodurch das Cellosolo zum Duo wird. Hier zusammen mit der Violine von Helena Winkelman, dort zusammen mit dem Blockflötisten Conrad Steinmann, dem Oboisten Matthias Arter oder dem Pianisten Anton Kernjak. Es gibt auch kurze Selbstgespräche, in denen Gohl zum Cello singt und summt. Darum herum finden sich noch weitere Gäste ein, Komponisten wie Schubert oder Offenbach, Dichter wie James Joyce, Paul Éluard oder Arthur Rimbaud, manchmal gut versteckt, manchmal offensichtlich. Denn Mosers Musik liebt die Allusion, sie geht gerne mit Worten um, bedächtig und sorgfältig, ohne Hast. Subtil beginnt sie immer wieder mal zu singen, mit romantischem Sentiment, ja fein sehnsüchtiger Hingabe. Und in … wie ein Walzer auf Glas … tanzt das Cello in den Flageoletttönen «vertrackt einfach», wie Roman Brotbeck in seinem schönen Booklettext schreibt. Andere Stücke führen auf die Grenzpfade der Mikrotöne.
So kurz die meisten Stücke sind, so hat jedes doch sein eigenes Gepräge. Grösseres Gewicht erhält hier nur eine Komposition von 1998, die gleich in zwei Versionen erklingt: zunächst in der neueren für Violine und Cello, am Schluss in der urspünglichen mit Oboe d’amore und Cello. … e torna l’aria della sera… basiert auf einer unhörbaren Ballata von Pier Paolo Pasolini und wandelt mit der Besetzung auch leicht den Charakter. Mal klingt dieser Abendgesang arkadisch, mal fast tristanhaft. Er bewegt sich frei und beharrlich, doch ohne Sturheit, und er entgeht dabei jedem allzu gängigen Innovationszwang. Die Musik atmet in diesen Interpretationen ganz selbstverständlich.

Roland Moser: Violoncello solo e in duo. Käthi Gohl Moser, Cello; Anton Kernjak, Klavier; Helena Winkelman, Violine; Conrad Steinmann, Flöte, Aulos; Matthias Arter, Oboe d’amore. Olinard Records








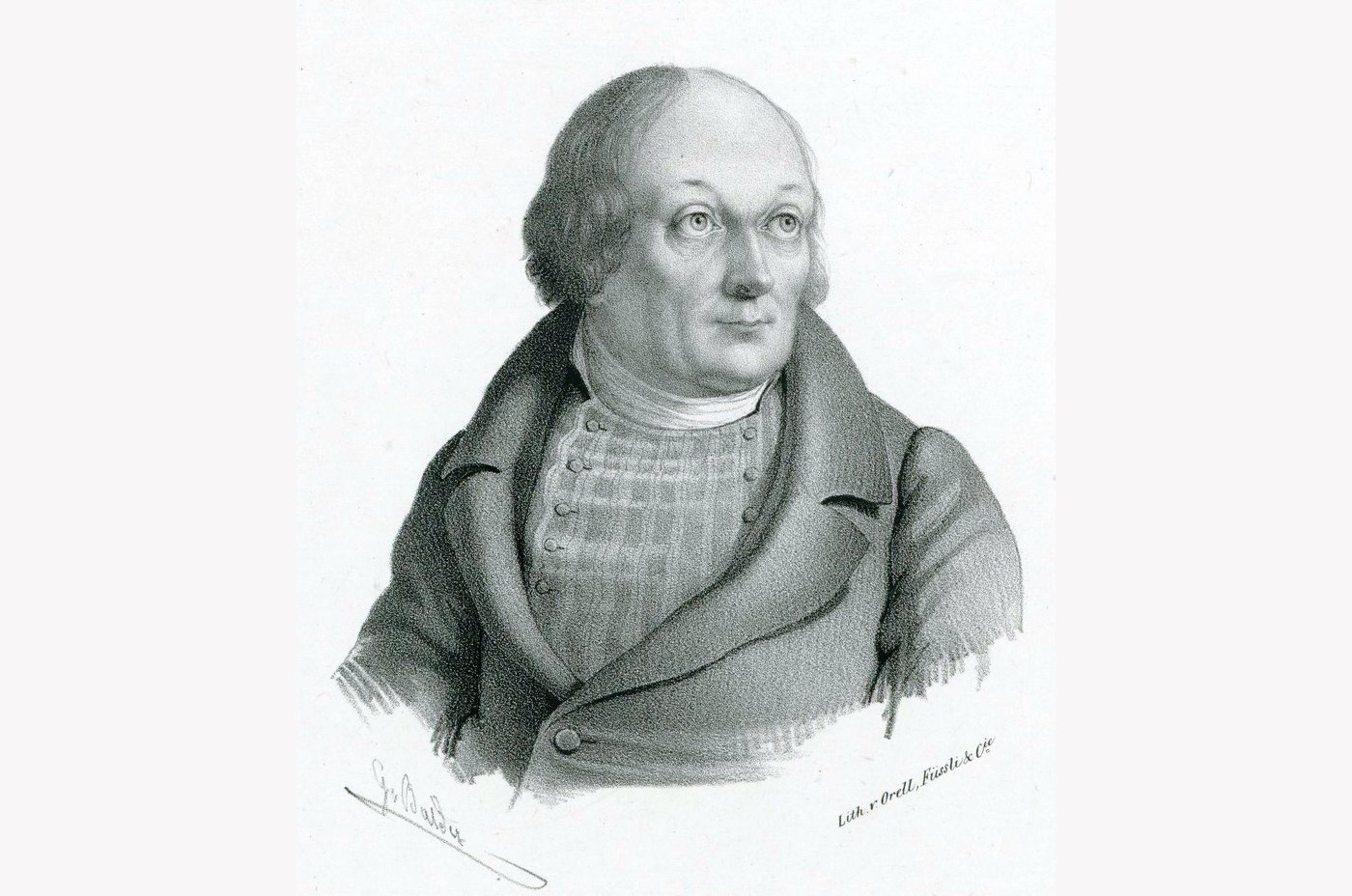


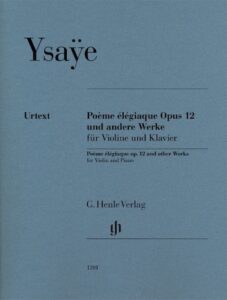




 Barbara Beuys: Emilie Mayer, Europas grösste Komponistin. Eine Spurensuche, 220 S., € 22.00, Dittrich, Weilerswist-Metternich 2021, ISBN 978-3-947373-69-7
Barbara Beuys: Emilie Mayer, Europas grösste Komponistin. Eine Spurensuche, 220 S., € 22.00, Dittrich, Weilerswist-Metternich 2021, ISBN 978-3-947373-69-7


 Mozart: Haffner Serenade. Festival Strings Lucerne, Daniel Dodds, violin & direction, Sony Classical 0196587250621
Mozart: Haffner Serenade. Festival Strings Lucerne, Daniel Dodds, violin & direction, Sony Classical 0196587250621