Freunde beidseits des Eisernen Vorhangs
Meinhard Saremba zeichnet in seinem Buch die Künstlerfreundschaft von Britten und Schostakowitsch nach.

Das Wagnis hat sich gelohnt, die beiden Komponisten aus dem Schatten der Politik zu holen, den englischen, Benjamin Britten (1913–1976), in der Zeit des Niedergangs eines Weltreiches, und den russischen, Dmitri Schostakowitsch (1906–1975), in der schreckenerregenden Sowjetzeit. Die 1960 eher zufällig sich ergebende Bekanntschaft, welche sich über die schier unüberwindliche Grenze des Kalten Krieges hinweg zur Freundschaft entwickelte, wird in den verschiedensten Facetten von künstlerischen und menschlichen Bezügen dargestellt. Allen Widerwärtigkeiten zum Trotz konnten sie sich sechs Mal treffen, sowohl in Aldeburgh wie in Moskau und auf der gemeinsamen Reise in Armenien (Sommer 1965).
Dabei bemüht sich der Autor, politische Grossereignisse wie die Kubakrise 1962, den Einmarsch der Warschaupakt-Staaten in die Tschechoslowakei 1968 und die hitzige Diskussion in Grossbritannien um das Festival sowjetischer Musik 1972 in die Auseinandersetzungen um die Entwicklung der Neuen Musik einzubauen, ohne den Fokus auf die beiden Künstler als bedrohte Existenzen zu vernachlässigen. Denn unter diesem Aspekt wurden sie vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Komponisten völlig kontrovers beurteilt, und die Diskussionen in Ost und West setzen sich heute unvermindert fort, da beide kaum je der Avantgarde zugezählt werden konnten und ihre Werke deshalb oft unter ihrem Wert be- und abgeurteilt wurden.
Zitate in Überfülle aus englischen und russischen Quellen – in weit über tausend Anmerkungen ausgewiesen – ersetzen oft eine vom Autor erwartete Stellungnahme. Primär aber geht es ihm nicht darum, die Werke neu zu beurteilen, sondern er beleuchtet die teilweise vergleichbaren schwierigen Umstände, unter denen die Werke entstanden sind, neu. Da sich beide Komponisten mit den politischen Ereignissen beschäftigen mussten und dadurch oft, aber nicht immer, ungewollt zu Mitbeteiligten wurden, erforderte dies umfangreiche Recherchen im privaten Umfeld. Der «Bedeutungswandel von Werten und Worten» oder Details zum Kulturaustausch-Abkommen zwischen Grossbritannien und der UdSSR im Jahr 1959 führen weit darüber hinaus, eröffnen aber oft Einblick in schon vergessene Vorkommnisse in der Zeit des Kalten Krieges.
Solche Überblicksbetrachtungen bergen allerdings die Gefahr, dass die geopolitischen Aspekte, aus der eingeengt kulturellen Perspektive begriffen, einer gesamthistorischen Beurteilung nicht immer standhalten. Hingegen ist es verdienstvoll, dass der Autor versucht, auch die problematischen Seiten der in Aussenseiterrollen gedrängten Individualisten zu beleuchten.
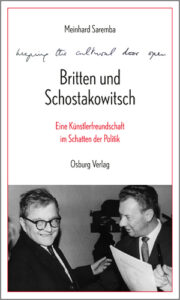
Meinhard Saremba: Keeping the cultural door open. Britten und Schostakowitsch. Eine Künstlerfreundschaft im Schatten der Politik, 518 S., € 28.00, Osburg-Verlag Hamburg, Eimsbüttel 2022, ISBN 978-3-95510-295-1







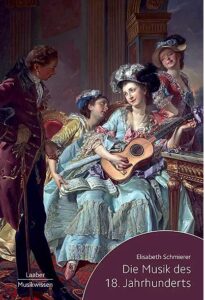


 Corin Curschellas: Collecziuns 1990–2010 + 2022 Her Songs, Tourbo Music TOURBO068
Corin Curschellas: Collecziuns 1990–2010 + 2022 Her Songs, Tourbo Music TOURBO068

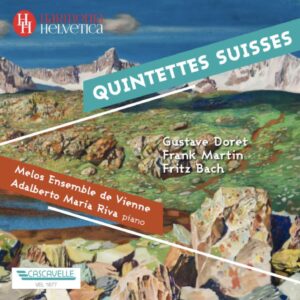


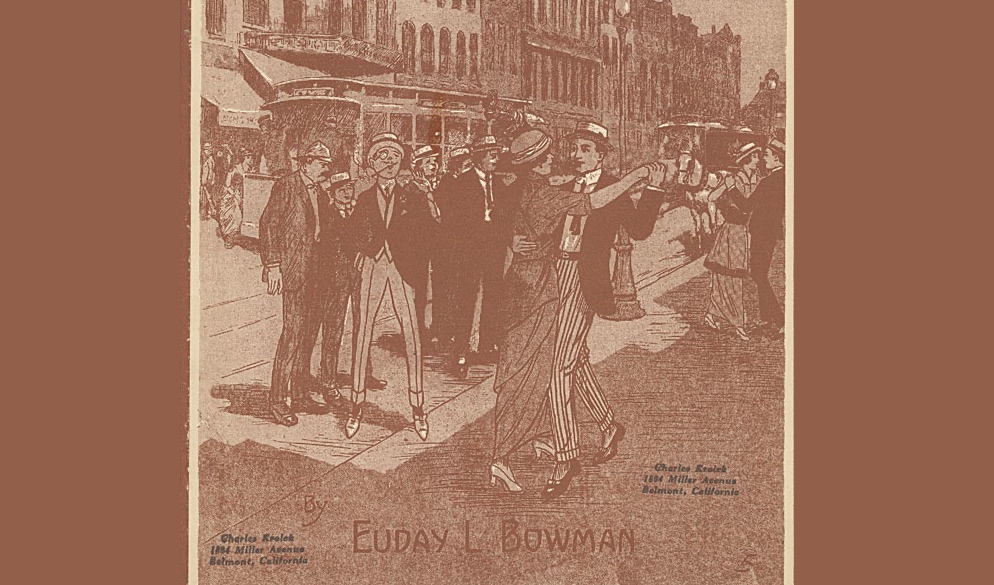
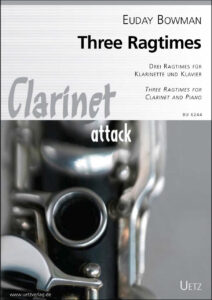 Euday Bowman: Three Ragtimes for Clarinet and Piano, arrangiert von Heinz Bethmann, BU 6244, € 15.00, Bruno Uetz Musikverlag, Halberstadt
Euday Bowman: Three Ragtimes for Clarinet and Piano, arrangiert von Heinz Bethmann, BU 6244, € 15.00, Bruno Uetz Musikverlag, Halberstadt
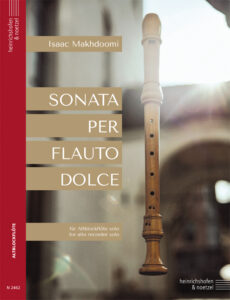 Makhdoomis Catching Moments hingegen ist eine zeitgenössische, traditionell notierte Komposition, die sich in drei Abschnitte gliedert und mit «mystisch, frei» überschrieben ist. Beginn und Ende haben einen improvisatorischen Charakter und erinnern an indische Flötenmusik. Immer wieder verweilt die Musik auf längeren Tönen, um sich in kurzen schnellen Läufen oder rhythmischen Sequenzen zu einer Pause oder dem nächsten langen Ton hinzubewegen. Der rhythmische, schnellere Mittelteil ist rhetorisch gedacht, beginnt mit geräuschvollen und genau notierten Silben, die in die Flöte gesprochen werden sollen und entlädt sich danach in Multiphonics und hörbarem Fingerklappern.
Makhdoomis Catching Moments hingegen ist eine zeitgenössische, traditionell notierte Komposition, die sich in drei Abschnitte gliedert und mit «mystisch, frei» überschrieben ist. Beginn und Ende haben einen improvisatorischen Charakter und erinnern an indische Flötenmusik. Immer wieder verweilt die Musik auf längeren Tönen, um sich in kurzen schnellen Läufen oder rhythmischen Sequenzen zu einer Pause oder dem nächsten langen Ton hinzubewegen. Der rhythmische, schnellere Mittelteil ist rhetorisch gedacht, beginnt mit geräuschvollen und genau notierten Silben, die in die Flöte gesprochen werden sollen und entlädt sich danach in Multiphonics und hörbarem Fingerklappern.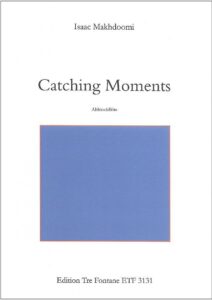 Auch als Interpret lässt sich Isaac Makhdoomi nicht einfach in eine Schublade stecken. Dem Fernsehpublikum ist er seit seinem Auftritt bei den «Grössten Schweizer Talenten» als Teil der Band Sangit Saathi bekannt, bei dem er der Blockflöte funkige Klänge entlockte und die Zuhörer begeisterte. Seine neu erschienene CD mit den Concerti von Antonio Vivaldi zeigt wiederum eine ganz andere Seite des Musikers. Das klug konzipierte und aussergewöhnlich schön abgemischte Album, in dem Makhdoomi den bekannten Concerti zwei Arien-Juwelen gegenüberstellt, überzeugt nicht nur durch kraftvolle Virtuosität, klar konturierte Dynamik, eine spannende Instrumentation im Continuo oder improvisatorische Momente, sondern vor allem durch eine grosse Individualität und Klangsehnsucht in den lyrischen und reich verzierten langsamen Sätzen.
Auch als Interpret lässt sich Isaac Makhdoomi nicht einfach in eine Schublade stecken. Dem Fernsehpublikum ist er seit seinem Auftritt bei den «Grössten Schweizer Talenten» als Teil der Band Sangit Saathi bekannt, bei dem er der Blockflöte funkige Klänge entlockte und die Zuhörer begeisterte. Seine neu erschienene CD mit den Concerti von Antonio Vivaldi zeigt wiederum eine ganz andere Seite des Musikers. Das klug konzipierte und aussergewöhnlich schön abgemischte Album, in dem Makhdoomi den bekannten Concerti zwei Arien-Juwelen gegenüberstellt, überzeugt nicht nur durch kraftvolle Virtuosität, klar konturierte Dynamik, eine spannende Instrumentation im Continuo oder improvisatorische Momente, sondern vor allem durch eine grosse Individualität und Klangsehnsucht in den lyrischen und reich verzierten langsamen Sätzen.
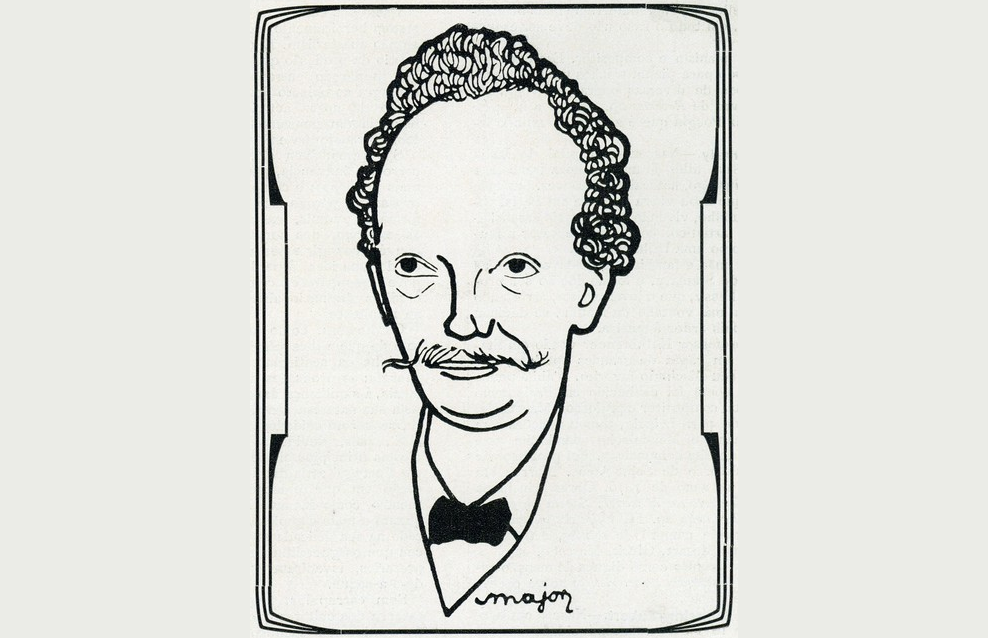


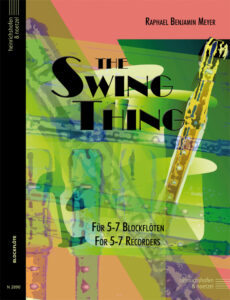



 Joachim Raff: Six Morceaux für Violine und Klavier op. 85, hg. von Stefan Kägi und Severin Kolb, EB 9407, € 28.50, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
Joachim Raff: Six Morceaux für Violine und Klavier op. 85, hg. von Stefan Kägi und Severin Kolb, EB 9407, € 28.50, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden




 Carl Friedrich Abel: Cellokonzert Nr. 2 C-Dur, WKO 60, hg.von Markus Möllenbeck, Klavierauszug, EW1112, € 24.80, Edition Walhall, Magdeburg
Carl Friedrich Abel: Cellokonzert Nr. 2 C-Dur, WKO 60, hg.von Markus Möllenbeck, Klavierauszug, EW1112, € 24.80, Edition Walhall, Magdeburg