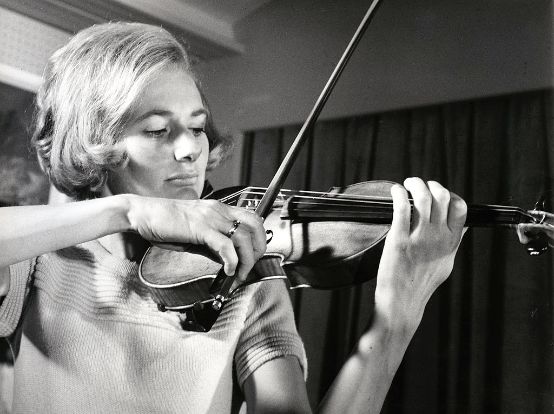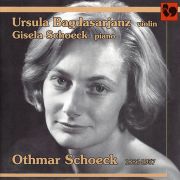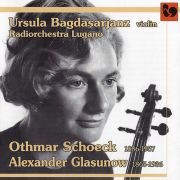Drei Künstlergruppen aus Deutschland, Ungarn und aus der Schweiz beschäftigten sich mit einem jeweils für das Land repräsentative Opernwerk – sofern es denn eines gibt. Von den Schweizern wurde in Ermangelung eines solchen stattdessen der Schweizerpsalm, der Bundesbrief und das Schweizer-Sein an sich in einer recht derb-körperlichen Art theatral umgesetzt. Doch der Reihe nach.
Distanziert mit «Freischütz»
Die Berliner Opernkompanie Novoflot widmete sich im ersten Teil der «ersten deutschen Nationaloper», dem Freischütz von Carl Maria von Weber (1786–1826). Die romantisch-düstere Geschichte um den Erbförster Kuno, die Försterstochter Agathe und den Jägersburschen Max wird der Frage gemäss inszeniert: Wer von ihnen macht wohl das Rennen? Drei kleine Mädchen machen sich Notizen auf Wettzetteln. Ein Posaunenchor spielt Geräuschhaftes unter Einsatz der Dämpfer. Ein Sprecher kommentiert das sportliche Geschehen, während die Sänger loslaufen, ihre Arien singen, stolpern und tot hinfallen.
Später nehmen sie die Position von Punktrichtern ein, die die sportliche Leistung bewerten. Ein eleganter junger Mann mit Zopf, vielleicht der junge Karl Lagerfeld, baut derweil das typisch deutsche Bühnenbild auf. Ein ausgestopfter Adler. Eine Dartscheibe mit nordischem Schiffsmotiv. Ein Wäscheständer, ein leerer Kühlschrank, eine Telefonzelle von der Telekom.
In reduzierter Form, zwischen Operngesang und Schauspielerstimmen changierend, werden die Gassenhauer des Freischütz hier geboten, was während eines Moments mit der ungewöhnlichen Kombination von Bassklarinette und Melodica besonders mitreissend gelingt. Ein grosser Augenblick ist der Auftritt des Kinderchors, wenn sich der ganze Bühnenraum plötzlich mit dieser Vielzahl von Mädchenkörpern und mit ihren zarten Stimmen füllt. Und doch gerät dieser Freischütz etwas zu lang, zu statisch und häufig zu ungenau in Timing und Artikulation. Während Ännchen und Agathe geschäftig von einer Seite der Bühne zur anderen eilen, in Kühltaschen wühlen und dabei Unverständliches singen, fühlt man sich gar zu sehr an die üblichen Operninszenierungen erinnert und merkt nichts mehr davon, dass man sich hier in einem besonderen Musiktheaterexperiment befinden soll. Und was war das jetzt eigentlich mit der Nationalität? Die Frage bleibt bei diesem Freischütz seltsam unberührt.
Ratlos mit Heidi
Und nun also der Schweizerpsalm der Zürcher Theatergruppe kraut_produktion. Auf der Bühne Bierbänke, darauf grüne und rote Abstimmungskarten. Blumentöpfe mit Heckengewächsen verstellen den Blick. Irgendwo sind Tombolapreise aufgebaut, an einem anderen Tisch sitzen die Darsteller und trinken. Schweizer sprechen schlechtes Englisch auf Unternehmenssitzungen, erfährt man, und sie schämen sich dafür, dass es ihnen so gut geht, deswegen versuchen sie möglichst nicht aufzufallen. Auf der Leinwand laufen Werbefilme für die Schweiz und für Parteien oder Menschen, die man wählen könnte.
Das Mitmach-Theater beginnt, mit Losverkauf und Damenwahl. Die beiden Frauen Wändy und Sändy spielen alberne Schenkelkrachersketche. Die viel zu laut eingestellte Anlage plärrt einem ins Ohr, und die Energie dieses halb improvisierten Aktionstheaters will sich nicht so recht übertragen. Irgendwann pissen alle Darsteller in eine Zinkrinne auf der Bühne. Penetrant plärrt eine Darstellerin, sie sei die Heidi und käme jetzt zurück aus Frankfurt zum Grossvater. Sie lässt sich mit einer Melkmaschine melken, die gewonnene Muttermilch wird zu Butter gemacht, die sich die Darsteller gegenseitig ins Gesicht schmieren. Irgendwie geht es auch um die Verantwortung des Einzelnen für die Gemeinschaft, vielleicht auch für diese Theatersituation. In all diesen Schweizer Klischees zwischen Heidi, Pisse und Milch ist von einem Gemeinschaftsgefühl jedenfalls nicht viel zu spüren, das hat eher den Anstrich von Wut und Selbstverachtung. Das Berliner Publikum bleibt da etwas ratlos zurück.
Gemeinsam berührt von «Bánk bán»
Ganz anders die Inszenierung der ungarischen Gruppe Krétakör. Auf der Bühne steht ein Grenzzaun der gleich zu Beginn fällt, von den Darstellern gemeinsam niedergerissen.
Die vielen jungen Menschen von Krétakör, die sich selbst als «Aktivisten» und nicht als Theaterkünstler bezeichnen, setzen sich in ihrem Stück mit der Oper Bánk bán* des Komponisten Ferenc Erkel (1810–1893) auseinander, die in drei Akten die Geschichte von der Ermordung der Königin Gertrud durch ungarische Adlige erzählt. Für ihre Annäherung (und Distanzierung) brauchen die Darsteller nicht viel. Auf der Bühne ist ein Pianist mit einem E-Piano, der die Musik aus der Oper in reduzierter Fassung zum Besten gibt. Die Darsteller spielen die Szenen der Oper nach, indem sie einfache Konstellationen und Posen einnehmen und in Kurzfassung die Texte wiedergeben. Für das deutsche Publikum wird das Wichtigste auf Englisch zusammengefasst. Im Hintergrund ist eine Videoleinwand, auf der historische Fotos, Bilder mit aktuellen Bezügen und Filmausschnitte zu sehen sind.
Ausgehend von der Opernhandlung ziehen die Aktivisten Parallelen zu aktuellen Ereignissen in Ungarn, von gedeckten Vergewaltigungen an der Universität über die Ungleichbehandlung von Frauen bis hin zur Ausgrenzung von Fremden, dem Misstrauen gegenüber Europa als Fremdherrschaft und dem Schüren von Hass durch die Stärkung des althergebrachten Nationalgefühls. Eine sehr viel schönere Fassung einer Nationaloper entwirft Krétakör, indem zu einer auf fünf Minuten komprimierten Klavierfassung von Bánk bán ein Film läuft, der die Gesichter ganz verschiedenerr Menschen unterschiedlichen Alters aus dem heutigen Ungarn zeigt. Ein einfaches Mittel, das seine berührende und verbindende Wirkung jedoch nicht verfehlt.
Schliesslich stellen die Aktivisten Fragen an das Publikum, und obwohl es im Raum heiss ist und der Abend schon weit fortgeschritten, beginnen die Zuschauer allmählich, sich diesen jungen Menschen zu öffnen und die Fragen zu beantworten. Was man tun würde, wenn man der Bürgermeister dieser Stadt wäre. Ob Künstler eigentlich wichtig für die Gesellschaft sind. Wenn es eine geheime Zutat für Gemeinschaften gibt, welche das ist. Respektvoll, verletzlich und ernsthaft stellen die Aktivisten von Krétakör ihre Fragen und lassen so eine Atmosphäre entstehen, in der etwas von der gesuchten Gemeinschaft spürbar wird – und von der Verantwortung des Einzelnen. Als zartes Pflänzchen, als mögliche Utopie, ganz abseits von jedem Nationalgefühl.
* Der deutsche Titel der Oper lautet: Banus Bánk. Banus ist die Bezeichnung für einen reichen Herrn. Der Stellvertreter des ungarischen Königs heisst in der Oper Bánk.