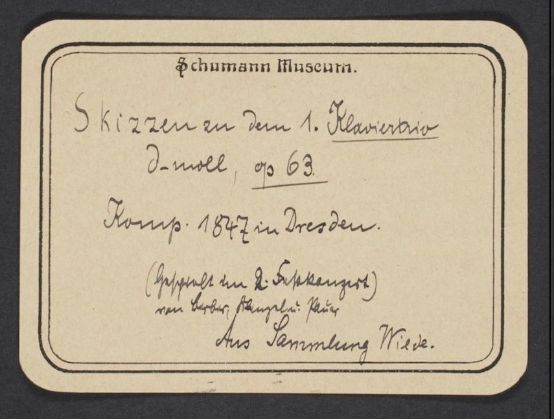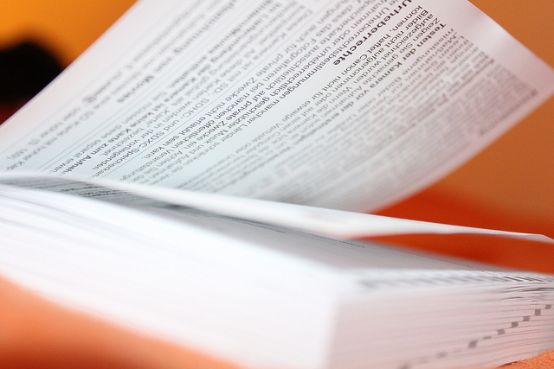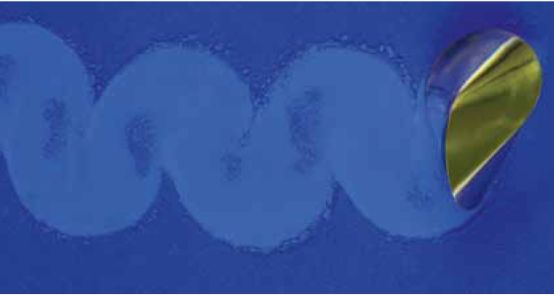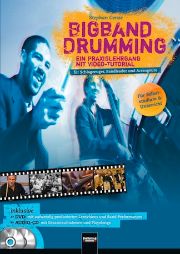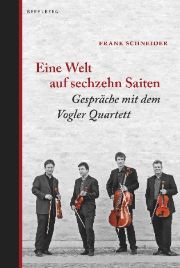Innenansichten aus der Welt der Kammermusik, speziell aus der noch immer mit der Aura des Mystischen versehenen Königsdisziplin Streichquartett, scheinen nach wie vor auf grosses Interesse zu stossen. Nach dem in bereits dritter Auflage befindlichen Buch von Sonia Simmenauer Muss es sein? – Leben im Quartett von 2008 (vergl. SMZ 9/2008, S. 35) bringt der Verlag Berenberg eine Publikation auf den Markt, die noch tiefere Schichten dieses traditionellen Viererbundes freilegt. Vielleicht war schon damals angedacht worden, das Thema später mittels eines ausgesuchten Quartetts genauer zu beleuchten, denn auf dem Titel war bereits das – passend zu Beethovens Titel sehr ernste – Bild des Vogler-Quartetts.
Im neuen Buch nun, auf dessen Vorderseite die Protagonisten über das in drei Jahrzehnten Erreichte zufrieden lächeln dürfen, kehren viele Themen wieder, stellen sich aber aus einem anderen Blickwinkel dar. Der Autor Frank Schneider, früher Intendant des Konzerthauses Berlin, sah sich im Entstehungsprozess nicht als Leitfigur, sondern hat im Gegenteil das Konzept dazu gemeinsam mit dem Quartettmitgliedern entwickelt, und zwar erst, nachdem sie ihn um seine Mitwirkung gebeten hatten. Man könnte also durchaus sagen, das Buch sei in einem der Kammermusik wesensverwandten Verfahren interaktiv gewachsen.
Obwohl – wie der Untertitel besagt – Gespräche die Grundlage für den finalen Text bilden, ist hier keine lockere Ansammlung von erörterten Themen mit einer sich aus sich selbst entwickelnden Dynamik entstanden. Die akribisch vorbereitete, durchdachte und sensibel pointierte Fragestellung des Autors verleiht dem Buch ein tragfähiges Rückgrat, eine Struktur, die auch weniger informierte Leser an die Hand nimmt und den Lesegenuss durch die formale Geschlossenheit aufrecht erhält.
Das Vogler-Quartett eignet sich in mehrerlei Hinsicht ganz besonders für ein solch aufwändiges Unterfangen. Seit 30 Jahren in gleicher Besetzung auf den Bühnen der Welt zuhause, steht es aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und der Herkunft der Musiker ganz besonders für eine deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte vor dem Hintergrund der aufregenden letzten Jahre der DDR und ihres Zusammenbruchs 1989 sowie der Wiedervereinigung Deutschlands 1990. Die Doppelspitze der Streichquartette der DDR hiess damals: Vogler- & Petersen-Quartett. Letzteres ist bedauerlicherweise schon vor einigen Jahren nach zahlreichen Besetzungswechseln aufgelöst worden. Geprägt von Eberhard Feltz, neben Robert Levine der Nestor unter den Quartettpädagogen alter Schule, betrat das Vogler-Quartett mit Aplomb das Parkett der internationalen Konzertbühnen nach seinem ersten Preis am Wettbewerb in Evian 1986. Wie man auf youtube auch heute noch schön nachvollziehen kann, handelte es sich bei den vier Musikern zu dieser Zeit um eine klassische Band, die äusserlich ganz dem spiessig-biederen DDR-Look entsprach, aber als Quartett eine derartige Ernsthaftigkeit und Präzision entfaltete, die – bar jeder westlichen Wurstigkeit oder Arroganz – die Kollegen und Kolleginnen völlig überraschend an die Wand spielte.
Mag sein, dass die Mitglieder des Vogler-Quartetts, die allesamt aus der zunehmend vom Aussterben bedrohten Gattung musikalisch aktiver und Hausmusik praktizierender Familien stammen, ihre – wie sie selbst sagen – stoische Bedächtigkeit nie ganz abgelegt haben und zuweilen eine gewisse emotionale Distanz entfalten. Dabei ist ihr musikalischer Impetus und vor allem der intellektuelle, analytische, informierte Unterbau ihrer Interpretationen einem Eisberg gleich, riesenhaft unter dem Sichtbaren, immer fühlbar und geradezu ehrfurchtgebietend. Ihre Disziplin, ihr Fleiss und ihr nimmermüdes Interesse an neuen Herausforderungen, seien es nun Kinderkonzerte, Neue Musik, genreüberschreitende Projekte (u. a. mit Ute Lemper, jüdischer Musik, Tango) oder ganze Festivalprogramme (u. a. Homburger Kammermusiktage, Drumcliffe Festival Irland), zeichnen sie immer wieder vor anderen Ensembles aus, die mit den immer gleichen programmatischen Inhalten kein neues Interesse für die fantastisch vielfältige Kammermusik wecken, sondern durch das Einbalsamieren der teilweise überkommenen Rituale und Konzertformate den Ast absägen, auf dem sie eigentlich noch eine Weile sitzen wollen.
Die vier männlichen Mitglieder des Quartetts (mittlerweile eine Minderheitenkonstellation unter den Ensembles) kommen alle zu gleichen Teilen zu Wort. Was an Ausgewogenheit innerhalb des Viererbundes schon allein an der unterschiedlich gewichteten Wahrnehmung der einzelnen Stimmen scheitern und sich der natürlichen Quartetthierarchie unterwerfen muss, gelingt dem Buch auf beeindruckende Weise. Natürlich wurden die Texte nach den Gesprächen bearbeitet. Zu geschliffen und perfekt wirken die Antworten, als dass sie auf dem hohen sprachlichen und inhaltlichen Niveau spontan hätten entstehen können. Gleichwohl fällt auf, dass bei allen vier Musikern ein Höchstmass an Wahrnehmung, Reflexion und Durchdringung der Wesensmerkmale des eigenen Tuns vorhanden ist. Das kann man wahrlich nicht von allen Quartetten behaupten. Nichtsdestotrotz sind es vier unterschiedliche Charaktere, die sich hier fanden, mit all ihren Eigenheiten, Schwächen und Stärken. Die 30 Jahre Zusammenhalt aber erzeugen eine derart substanzielle Schicht an Gemeinsinn und erlebter Geschichte, dass man wie selten von einer «Ehe zu viert» sprechen kann. Man mag als nicht eingeweihter Leser schmunzeln über die Not mit zu niedrigen Stühlen oder den zuweilen sozial anstrengenden Afterconcert-Partys. Dass aber das ernsthafte Quartettspiel auf höchstem Niveau kein Beruf, sondern ein prioritäres Leben im Leben bedeutet, an dem sich alles andere ausrichtet, das kommt sehr schön zum Ausdruck. Es werden auch offen teuerste Verluste beklagt, die das künstlerische Tun verursacht hat, wie beispielsweise zerbrochene Ehen oder Beziehungen.
Trotz der Fülle des Buches und der vielen Einzelheiten, die es bespricht, gäbe es noch viel mehr zu sagen und zu fragen. Zum Beispiel, was eigentlich den Kern der bald dreihunderjährigen Faszination am Streichquartett ausmacht, warum so viele Komponisten ihr Wertvollstes dieser Gattung widmeten? Oder wie wäre es mit einem Buch der Partner der Streichquartettmusiker und deren Sicht auf die omnipräsente zeitliche und emotionale Konkurrenz? Wer weiss, vielleicht gibt es in ein paar Jahren ein weiteres Buch, das die Geschichten fortschreibt und ergänzt und uns den Kosmos Streichquartett wieder neu erklärt.
Frank Schneider, Eine Welt auf sechzehn Saiten. Gespräche mit dem Vogler Quartett, 384 S., € 25.00, Berenberg-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-937834-80-1