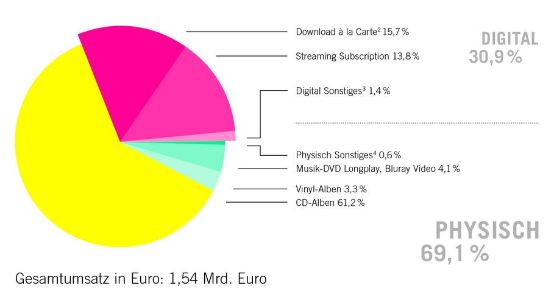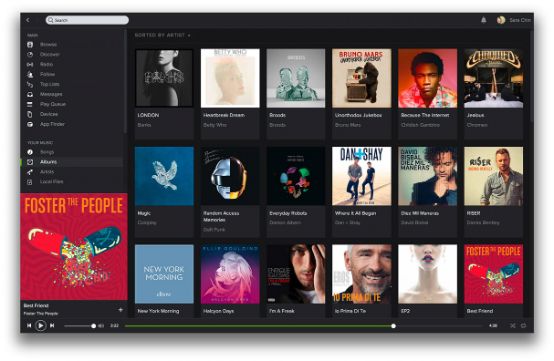An den Musikschulen sinkt die Nachfrage nach Klarinettenunterricht stetig, obwohl kaum ein Blasinstrument breitere stilistische Anwendungsmöglichkeiten bietet. Von der Klassik über die Volksmusik bis hin zu Klezmer und Jazz – überall wird die Klarinette eingesetzt. Sie ist eines der beweglichsten und vielseitigsten Blasinstrumente überhaupt. Was liess sich der Schweizer Blasmusikverband nicht alles einfallen, um dieses, nicht zuletzt von Mozart hochgeschätzte Instrument vermehrt in den Fokus zu rücken: Konzerte landauf, landab, Flashmobs, das grösste Klarinettenensemble, der längste Klarinettenton und ein Klarinettenbus, der auf Aufklärungstour quer durch die Schweiz geschickt wurde.
Auf den Spuren des Erfinders
An der Musikschule Burgdorf kam man im Januar 2015 auf eine ebenso originelle wie naheliegende Idee, um das Jahr der Klarinette zu bereichern. In den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts stöberte der Klarinettist und Musiklehrer Andreas Ramseier auf einem Freiburger Trödelmarkt den Klavierauszug einer Oper auf. Es war das Werk des weitgehend unbekannten Nürnberger Komponisten Friedrich Weigmann (1869–1939) mit dem Titel Der Klarinettenmacher auf. Das Libretto entstammt der Feder des Musikforschers, Kapellmeisters und Verfassers des Reclam-Opernführers Georg Richard Kruse (1856–1944).
Die Erfindung der Klarinette wird Johann Christoph Denner (1655–1707), einem berühmten Musikinstrumentenbauer des Barock zugeschrieben. Denner fügte dem Chalumeau, das den Umfang einer grossen None hat, eine Zusatzklappe an, sodass der Tonumfang des Instruments in die mittleren und hohen Register hinauf durch Überblasen erweitert werden konnte. Der Klang der oberen Töne erinnerte an den Clarinoklang der Barocktrompete, weshalb das neue Instrument den Namen Klarinette erhielt. Johann Christian Denner ist denn auch die Hauptperson der Oper. Inwieweit die Handlung tatsächlich den historischen Tatsachen entspricht, entzieht sich heutiger Kenntnis, ist aber auch nicht weiter von Belang.
Uraufführung der Burgdorfer Fassung
Der Klarinettenmacher wurde 1913 am Bamberger Theater uraufgeführt und stand in der Folge auf den Spielplänen einiger deutscher Bühnen, darunter des Schillertheaters Hamburg. Heute ist das Werk in keinem Opernführer zu finden und ausser dem einen Klavierauszug fehlt das gesamte Material. Es ist während des Ersten Weltkriegs offenbar verschwunden.
Roger Müller hat für die Inszenierung im Casino Theater Burgdorf auf der Basis der Klavierbegleitung eine anderthalbstündige, farbige, vielschichtige Partitur für Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte/Saxofon, Akkordeon, Orgel, Gitarre geschrieben. Weigmanns Musik ist schwer einzuordnen, besitzt aber spätromantische Züge. Vom Inhalt her handelt es sich um eine Spieloper, doch die durchkomponierte Form steht dieser Gattungsbezeichnung entgegen. In die Solopartien ist viel Text gepackt worden, was der Melodieführung und dem musikalischen Spannungsbogen nicht eben zuträglich ist. Vielleicht hätten dem Werk gesprochene Dialoge im Sinne der Spieloper gut getan. Duette sind Mangelware und Gesangsensembles fehlen gänzlich. Die wenigen Chorstellen des Stücks werden in der Burgdorfer Fassung ökonomischerweise vom Orchester übernommen.
Ein Instrument wird besungen
In der lebendigen Regie von Ueli Eggimann und im zeichnerisch konzipierten Bühnenbild von Matthias Egger, das in wechselnde Farbkonstellationen getaucht wurde, entfaltete sich ein engagiertes Spiel mit guten Gesangsleistungen. Neun Solorollen galt es zu besetzen, darunter die umfangreiche Titelrolle des Klarinettenmachers Johann Christoph Denner, der Roger Bucher seinen beweglichen Bariton lieh. Sein Tüfteln am neuen Instrument geht einher mit Geldproblemen und Liebeskummer. Sobald seine Klarinette nach Wunsch klingt, klappt es auch mit der Liebe.
Als Kunde des Instrumentenbauers tritt der Komponist und Organist Johann Pachelbel in Erscheinung. Martin Weidmann gelang hier mit prägnanter Stimme und viel Komik ein Kabinettstück. Bettina Bucher verkörperte Denners reiche Angebetete Maria Clara Neufville, die sich schliesslich durch Denners verführerischen Klarinettenklang mit den Worten «Lass mich dein Klarinettchen sein» rumkriegen lässt. Sie durfte mit ihrem leichten, gut geführten Sopran die schönsten, auch lyrisch ansprechenden Stellen des Stücks gestalten. Barbara (Sandra Rohrbach) gefiel mit ihrer burschikosen Art. In der Hosenrolle des Gabriel Schutz trumpfte Diana Gouglina mit dramatischen Tönen auf, während der zwielichtige Dr. Betulius (Fabio de Giacomi) buffonesk überzeugte. Der Nachwuchs, mit Tobias Wurmehl in der Rolle des Jägers Doppelmayr, Emanuel Gfeller als tollpatschiger Gehilfe Zick und Sophie Aebersold als Mädchen, setzte sich vorteilhaft in Szene. Die Capella Burgdorf musizierte unter der Leitung von Armin Bachmann.
In ein paar Monaten eben mal eine Opern-Uraufführung auf die Bühne zu stellen, ist eine beachtliche Leistung. Die Musikschule Region Burgdorf darf auf das Ergebnis stolz sein. Die besuchte Aufführung war die Derniere vom 7. Januar.