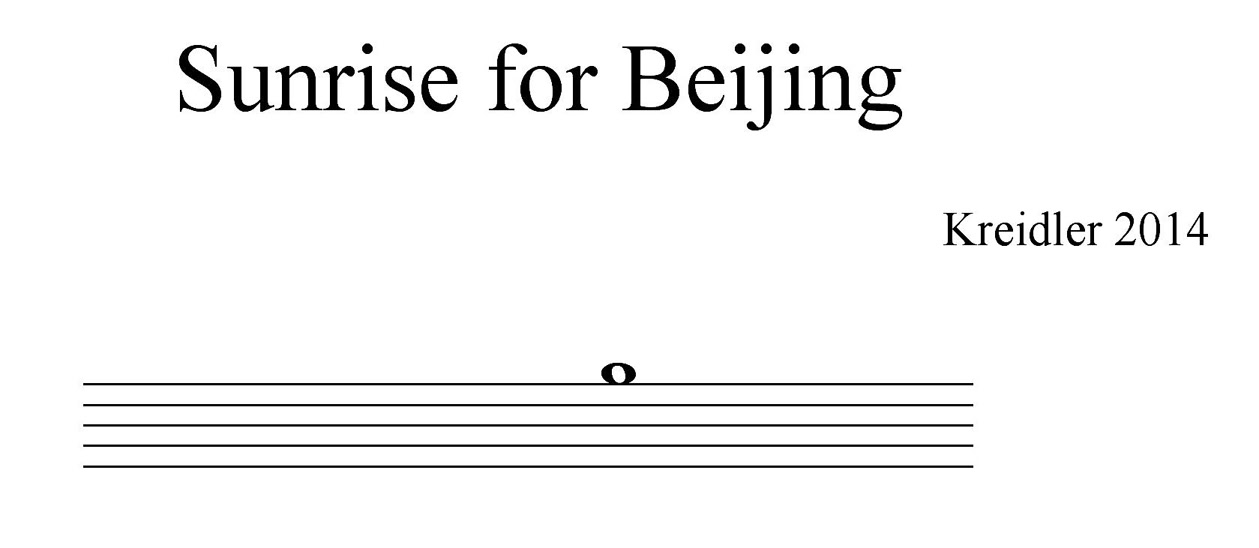Eine Wendeltreppe führt in den Keller des Staatlichen Instituts für Musikforschung mitten in Berlin. Hier, hinter der unscheinbaren weiss gestrichenen Eisentür liegt der wahrscheinlich stillste Ort der Stadt, ein reflexionsarmer Raum. Gebaut wurde er Anfang der 1980er-Jahre, heute werden hier Sprach- oder Instrumentalaufnahmen gemacht. Als ich die schwere Doppeltür öffne, weht mir abgestandene Luft entgegen. Die Wände sind komplett mit hautfarbenen Dämmkeilen gepolstert. Der Boden besteht aus einem schwebenden Gitter. 99 Prozent der Geräusche werden dadurch absorbiert. Kein einziger Laut von aussen dringt herein. Durch die Haus-in-Haus-Konstruktion wird kein Schall übertragen. Und auch wenn ich schreien würde, hörte es draussen niemand.
In dieser «Camera silens» will ich meinen Selbstversuch starten. Ich möchte herausfinden, wie angenehm oder quälend Stille sein kann. Wie lange werde ich es hier aushalten? Was werde ich wahrnehmen? Werde ich eine Erfahrung machen, an die ich lange und gerne zurückdenke?
Untersuchungen in Schallschutz-Kabinen wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Im psychologischen Labor der Yale University existierte ein «room in room», in dem Versuchspersonen hinter dicken Wänden und doppelten Türen, abgeschirmt von der Aussenwelt, Experimenten unterzogen wurden. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht von den Testleitern und Apparaturen beeinflusst und abgelenkt wurden.(1) In den 1950er-Jahren gab es in den USA und Kanada Experimente mit der sogenannten sensorischen Deprivation, dem Entziehen von Sinneseindrücken. Ziel war es, psychische Erkrankungen zu erforschen und neue Behandlungsmethoden zu finden. Der kanadische Psychologe Donald Hebb brachte seine Probanden in abgeschlossenen Räumen unter. Ihre Wahrnehmungen waren zusätzlich durch Augenbinden, schalldichte Kopfhörer und Handschuhe blockiert. Die Folge waren Angstanfälle und Halluzinationen. Ähnliche Versuche wurden in den 1960er-Jahren in Prag und in Hamburg gemacht.(2)
Der Sozialforscher Albert Biderman schrieb Ende der 1950er-Jahre, mit Isolation, Desorientierung und Stress könne der Wille von Menschen gebrochen werden. Seine Schriften wurden für die Ausbildung von Verhörspezialisten in Guantánamo eingesetzt.(3)
Stille ist eine Foltermethode, die in vielen Ländern genutzt wird. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nennt in ihrem jüngsten Folter-Bericht die Isolation als eine von vielen weltweit praktizierten Foltermethoden. Dabei befinden sich die Opfer monate- oder sogar jahrelang in Einzelhaft. Einzelzellen sind auch aus Gefängnissen bekannt, beispielsweise jenen der DDR-Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. In den Kellertrakt drang kein Tageslicht. Somit waren Tages- und Jahreszeit unbestimmbar. Auch der Kontakt zu Mithäftlingen fehlte. Eine Verständigung untereinander war nur durch Klopfzeichen möglich. Ehemalige Inhaftierte berichten von Halluzinationen, psychischen und depressiven Störungen, emotionaler Abstumpfung und extremer Sensibilisierung für Geräusche und visuelle Reize.(4)
Zurück in den Untergrund des Staatlichen Instituts für Musikforschung. Komplett dunkel ist es im reflexionsarmen Raum glücklicherweise nicht, in der Ecke baumelt eine Kellerlampe. Der Druck auf den Ohren ist unangenehm, als wären sie mit Watte ausgestopft. Dazu kommt ein tinnitusartiges Pfeifen. Überdeutlich nehme ich die Geräusche meines Körpers wahr. Trotzdem fühle ich mich auch geborgen zwischen dem ganzen Schaumgummi.
Ich habe eine Uhr dabei, ansonsten würde es mir schwer fallen, die Zeit einzuschätzen. Abgeschirmt von Tageslicht und Luft vergeht sie schneller als sonst. Mittlerweile sind 25 Minuten vorbei. Obwohl eigentlich unmöglich, bilde ich mir ein, Geräusche von draussen zu hören, wie von einem Spielplatz. Sind das schon Halluzinationen? Das Kratzen meines Bleistifts auf dem Papier beruhigt mich. Ein Institutsmitarbeiter schaut aus Sicherheitsgründen kurz herein. Nachdem er die Türen wieder geschlossen hat, verstärkt sich das Rauschen in meinen Ohren. Zehn Minuten später breitet sich ein leichter Kopfschmerz aus. Ich spüre meinen Herzschlag. Mein linkes Augenlid beginnt zu zucken.
Wenn keine Geräusche zu hören sind, wie hier im schalltoten Raum, ist die Zeitwahrnehmung gestört. Auch für die Halluzinationen gibt es eine rationale Erklärung. Da das Gehirn auf permanente Stimulation angewiesen ist, entladen sich die Nervenzellen immer wieder selbst. So entstehen die «künstlichen» Bilder.(5) Davon berichten auch Probanden, die an dem BBC-Versuch Total Isolation teilnahmen. 48 Stunden lang verbrachten sie abgeschirmt in völliger Dunkelheit in einem Bunker. Währenddessen sahen sie Autos, Schlangen oder auch Zebras. Über 60 Jahre nach den ersten Forschungen sind die Folgen der Isolation offenbar noch nicht vollständig untersucht.
Eigentlich sehnen wir Grossstädter uns nach Stille. Sooft es möglich ist, versuchen wir uns eine Auszeit zu nehmen von Lärm und Stress. Hier – mitten in der Innenstadt – ist es nun endlich vollkommen still. Und das ist kaum zum Aushalten.
Mittlerweile ist eine Stunde vergangen. Der permanente Druck auf den Ohren, der auch durch Gähnen nicht verschwinden will, und das Tinnitus-Piepen lassen nicht nach. Ich muss wieder raus, in die Wirklichkeit. Ich wuchte die Schaumgummipolsterung und die schwere Tür zur Seite, laufe die Wendeltreppe nach oben, vorbei am Pförtner, und darf endlich wieder frische Luft atmen. Die Sonne blendet. Ich kneife die Augen zusammen und denke: Wie viel mehr muss Gefangenen nach Tagen, Monaten oder Jahren das Tageslicht bedeuten als mir jetzt!
Anmerkungen
1 Vgl. Schmidgen, Henning, Camera Silenta. Time Experiments, Media Networks, and the Experience of Organlessness, in: Osiris, Vol. 28, No. 1, Music, Sound and Laboratory from 1750-1980, University of Chicago Press 2013, S. 171 ff.
2 Vgl. zu diesem Absatz: Koenen, Gerd, Camera Silens. Das Phantasma der «Vernichtungshaft», http://www.gerd-koenen.de/pdf/Camera_Silens.pdf, S. 8 ff., zugegriffen am 19.05.2014.
3 Vgl. Mausfeld, Rainer, Psychologie, «weisse Folter» und die Verantwortlichkeit von Wissenschaftlern, in: Psychologische Rundschau, 60 (4), Göttingen 2009, S. 233.
4 Vgl. Lazai, Christina; Spohr, Julia; Voss, Edgar, Das zentrale Untersuchungsgefängnis des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes in Deutschland im Spiegel von Opferberichten, http://www.stiftung-hsh.de/downloads/CAT_212/ZZ-InterviewauswertungMGB-MfSONLINE.pdf, zugegriffen am 18.05.2014.
5 Vgl. Kasten, Erich, Psychologisches Phänomen: Wenn das Hirn sich auf einen Trip macht, http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologisches-phaenomen-wenn-das-hirn-sich-auf-einen-trip-macht- a-795483.html, zugegriffen am 19.05.2014.