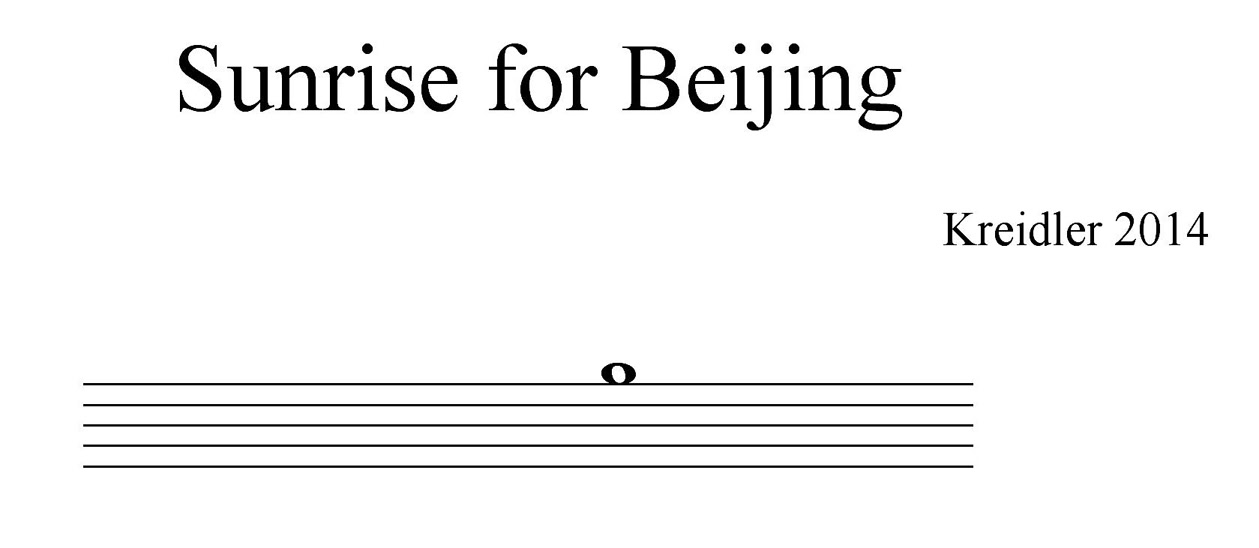Stille Nacht
So paradox es klingen mag: Das berühmte Weihnachtslied drückt Stille mit Hilfe von Musik aus. Bei Penderecki winkt es als Erinnerung, bei Schnittke wird es neue Gegenwart.

Wenn man im Duden das Wort «Stille» nachschlägt, so wird man überrascht: «Durch kein lärmendes, unangenehmes Geräusch gestörter [wohltuender] Zustand», heisst es da. Die Stille beinhaltet entgegen allen Annahmen «Geräusche», zwar nur angenehme, nicht-lärmende, aber doch Laute.
So scheint es heutzutage paradox, dass die Wintermonate und vor allem die Adventszeit als «stille Jahreszeit» gelten – sind sie doch geradezu von lärmenden Dauerschleifen-Weihnachtsliedern, Lautsprecherdurchsagen zu einmaligen Weihnachtsschnäppchen und quengelndem Kindergeschrei dominiert. Alles in allem keineswegs angenehme Geräusche. Und diesen zu entfliehen, stellt sich als grössere Herausforderung heraus, als man meint. Selbst dann, wenn die Natur zu ihrem letzten Mittel greift und versucht, die Welt mit schalldämmendem Schnee zu «beruhigen», ertönt allgegenwärtig und ironischerweise aus irgendeiner Ecke noch leise eine Schlagerversion des Weihnachtsklassikers Stille Nacht.
Dieses Lied, 1818 niedergeschrieben vom Österreicher Franz Xaver Gruber, beschäftigt sich damit, Stille in Form von Klängen auszudrücken. Die «stille Nacht», im christlichen Kontext die Nacht der Geburt Christi, kann als Inbegriff des «stillen Liedes», eines musikalischen Zustands von wohlklingenden Geräuschen, gesehen werden.
Er wählt dafür die Form der Siciliana, ein Satztypus, der sich durch einen markanten punktierten Rhythmus auszeichnet, und nichtsdestoweniger die Erinnerung an ein pastorales Wiegen- und Schlaflied erweckt. Dieser Rhythmus und der wellenartige, pendelnde Melodieverlauf verleihen dem Lied einen beinahe statischen, ruhenden Charakter und das vorgezeichnete Piano, das nahezu im Nichts verebbt, bekräftigt diesen noch. Man mag sich fast vorstellen, dass das scht von «stille Nacht» einem beruhigenden Zuflüstern der Mutter zu ihrem Kinde gleicht. Die Definition des Dudens für Stille scheint hier voll und ganz zuzutreffen – die behagliche Nacht wird weder durch ein lärmendes noch durch ein unangenehmes Geräusch gestört.
Die Faszination, die dieses Lied auf die Welt ausübt, zeigt sich in seiner unvergleichlichen Rezeption. Bereits zehn Jahre nach seiner Komposition wurde es in ganz Europa und der USA aufgeführt, und heute existiert es in unzähligen Sprachen. Es liegt in über hundert Versionen vor, von Heintje und Heino bis Elvis Presley und den Tiroler Herzensbrechern. Es ist kaum verwunderlich, dass so ein populäres Lied auch den Einzug in die Kunstmusik gefunden hat. Seine Thematik, die Stille, die Auseinandersetzung mit dem «Nicht-Ton», beschäftigt die Kunstmusik von jeher. In der Neuen Musik wird sie vor allem in den 1950er-Jahren mit John Cage zum Thema. Seine Inszenierung der Stille gilt als Ausgangspunkt etlicher Kompositionen, die die Stille thematisieren. Man suchte nach den Klängen, die an das Hörbare grenzen. Dieser Zeit entspringen besonders leise Werke, durchzogen von Pausen und dynamischen Extremen, die morendo aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen.
Etwas später als Cage setzt sich auch Krzysztof Penderecki in seinen Dimensionen der Zeit und Stille (1959/1960) intensiv mit dem Phänomen auseinander. Doch die Idee, das Thema mit dem Lied Stille Nacht, heilige Nacht zu verknüpfen, kommt ihm erst knapp zwanzig Jahre später. In seiner 2. Symphonie spielt er darauf an und verleiht ihr den Untertitel Christmas Symphony. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit des Hörers auf das Lied, das im Werk selbst beinahe «hereinklingt». Die 1980 unter ihrem Widmungsträger Zubin Mehta uraufgeführte Komposition basiert auf einem simplen Sonatensatz. In dieser Struktur dringt signalartig dreimal Stille Nacht, heilige Nacht durch; bei den ersten beiden Malen auch deutlich mit «quasi da lontano» gekennzeichnet. Allerdings zitiert Penderecki das Weihnachtslied nicht vollständig. Lediglich der erste Takt, quasi das erste «Stille Nacht», erklingt. Somit gleicht das Zitat eher einer Reminiszenz, die durch ihre Kürze und aus der Ferne im Pianissimo erklingend – fast schon emblematisch – weihnachtliche Assoziationen hervorruft. Für ihn scheint sich die Stille in der flüchtigen Erinnerung zu äussern, die einem allein durch das Zitat eine verlorene Vergangenheit ins Gedächtnis ruft.
Ganz anders hat Alfred Schnittke das Weihnachtslied zwei Jahre zuvor verarbeitet. Sein Stille Nacht für Violine und Klavier, 1978 uraufgeführt, ist im Gegensatz zu Pendereckis 2. Symphonie eine Bearbeitung, keine Anspielung. Er zitiert das Lied in seiner ganzen Länge, verfremdet es aber nach und nach. Anfangs spielt die Violine in Doppelgriffen solistisch einer scheinbar klaren G-Dur-Melodik entgegen. Doch diese wird bald durch Dissonanzen gestört, durch verstörende Sekundklänge und später durch Tritoni des Klaviers. Der Kontrast zum Original wird immer deutlicher. In der letzten Strophe löst sich die Melodie durch Flageoletts und Oktavversetzungen in der Violine nach und nach auf und verklingt in einem «ritenuto molto», in der Stille. Schnittkes Bearbeitung mündet also nicht in der Wiederkehr des Bekannten, ist keine nostalgische Rückversicherung wie bei Penderecki. Bei ihm wird das vermeintlich Bekannte durch seine Verfremdung Schritt für Schritt zu einer neuen Gegenwart, die sich aber in der Stille verliert. Schnittke führt sein Weihnachtslied am Ende zurück in einen «durch kein lärmendes, unangenehmes Geräusch gestörten [wohltuenden] Zustand».