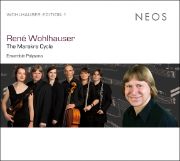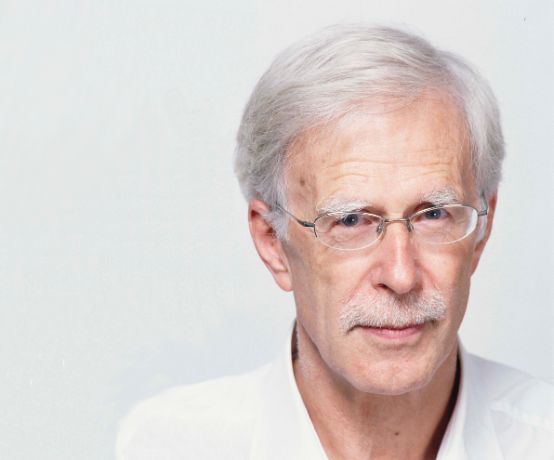Schattenhafte Klangpoesie
Vielverprechender Beginn der «Wohlhauser-Edition» mit einem zentralen Werkzyklus, der auf eignen Lautgedichten basiert.

«Komplexe Mikrostrukturen gestalten, mit Bruchstücken aus einer bruchstückhaften Welt arbeiten, die sich zu neuen Klang-Konglomeraten zusammenfügen, die dem Publikum vielleicht neue Erfahrungen und Sichtweisen eröffnen.» Dies sind die kompositorischen Prämissen von René Wohlhauser, einem spartenübergreifend agierenden Künstler, der als Komponist, Improvisatour, Pianist, Bariton, Musikpädagoge, Theoretiker und Schriftsteller gleichermassen umtriebig unterwegs ist. Jetzt hat das an der Baseler Musikakademie lehrende Multitalent mit eigenem Ensemble einen seiner zentralen Werkzyklen aufgenommen: The Marakra Cycle (2006–2011) – gelungener Start der «Wohlhauser-Edition» beim Label Neos.
Titel wie mira schinak, ’Srang, Sokrak und Charyptin muten esoterisch bis exotisch an, beruhen jedoch auf der Tatsache, dass diesen Stücken Lautpoesie (natürlich aus Eigenproduktion) zugrunde liegt. Sie überschreiben eine Musik, die von einer bemerkenswerten Klarheit der Diktion ist. Webern und Scelsi scheinen Wohlhauser gleichermassen inspiriert zu haben.
Konstruktive Verbindlichkeit zeichnet die Stücke für Sopran, Bariton, Flöte, Klarinette, Violine, Cello, Klavier und Perkussion (in verschiedenen Kombinationen zwischen Solo und voller Ensemble-Besetzung) ebenso aus wie Aspekte des Flüchtigen und Augenblickhaften, was die Musik in immer neue Richtungen führt, weil einzelne Elemente jederzeit produktive Eigendynamik gewinnen können.
Das «Erforschen der Tiefendimensionen des Klanges» ist erklärtes Ziel von Wohlhausers Ästhetik, die geräuschhaft, stationär oder virtuos daherkommt und auch auf reine Lautproduktion konzentriert sein kann. Ganz wichtig für die Wirkung dieser Klänge ist Christine Simolkas unaufgeregter Sopran, der den Hörer fortträgt bis zum Marakra Code 2, dramatischer Höhe- und Endpunkt des Zyklus, wo sich Wohlhausers Fantasiesprache zu trügerischen Bedeutungen verdichtet.
René Wohlhauser: The Marakra Cycle; Ensemble Polysono (Christine Simolka, Sopran; Ursula Seiler Kombaratov, Flöte; Igor Kombaratov, Klarinette; Markus Stolz, Violoncello; René Wohlhauser, Klavier, Bariton und Leitung; Gäste: Tabea Resin, Flöte; Marzena Toczko, Violine), Neos 11308