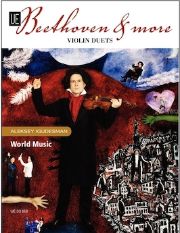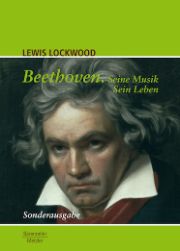Bettina Skrzypczak über ihre Komposition «Oracula Sibyllina», über künstlerisches Engagement und die Frage, wie das Leben nach Corona weitergehen könnte.
Bettina Skrzypczak lebt in Riehen und unterrichtet Komposition, Theorie und Musikgeschichte an der Hochschule Luzern/Musik. Im Februar wurde sie mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis 2020 ausgezeichnet, und im Mai erhielt sie den Kompositionswerkbeitrag des Kantons Aargau für das Jahr 2020. Als das Musikkollegium Winterthur, geleitet von Pierre-Alain Monot vor über fünf Jahren ihre Oracula Sibyllina für Mezzosopran (Mareike Schellenberger) und Orchester uraufführte, war dies das Resultat einer jahrelangen Beschäftigung mit antiken Orakeln und Prophetinnen. Heute ist das Werk aktuell wie nie zuvor.
Bettina, deine Komposition beginnt mit den Worten: «Ich bin Sibylle.» Deshalb zuerst die Frage: Wer ist diese Sibylle?
Das ist eine Kunstfigur.
Interessant! Und wie ist sie zusammengesetzt?
Dazu muss ich etwas ausholen. Die Sibyllen waren weise Frauen, die prophezeiten – weibliche Propheten. In der Antike werden sie von Heraklit erstmals erwähnt. Der römische Autor Varro nennt zehn Sibyllen mit je eigenen Prophezeiungen. Ihre Weissagungen beziehen sich nicht auf historisch lokalisierbare Menschen oder Fakten, sondern auf die menschliche Existenz ganz allgemein, meist in Form von Warnungen. Die Texte sind zeitlos aktuell, und das hat mich beeindruckt. Zwei dieser Sibyllen haben mich besonders interessiert, die Sibylle aus Erythrai und die berühmte Sibylle von Cumae aus der Nähe von Neapel. Auf ihren Aussagen beruht mein Text.
Das klingt nach einem langen Entstehungsprozess.
Ich habe mich monatelang mit der Thematik beschäftigt und mir viele Gedanken gemacht. Die Textkompilation war die erste Stufe der Komposition, und die Musik wuchs gemeinsam mit dem Text, wenn auch zuerst nur in meinem Kopf. So entstand das Porträt einer Sibylle als Ergebnis meiner Fantasie. Sie verkörpert all das, was ich beim Studium der Texte entdeckt und empfunden habe.
Wie charakterisierst du diese Sibylle?
Die Charakterisierung folgt einer genauen Dramaturgie. Es gibt drei Phasen, und jede endet mit dem warnenden Appell: «Höret!» Im ersten Teil stellt sie sich vor: «Ich bin Sibylle, des Phoibos weissagende Dienerin. Ich bin Tochter der Nymphe Naias.» Das ist der springende Punkt: Sie ist Tochter eines irdischen Naturwesens und zugleich Dienerin von Phoibos Apollon, dem «Leuchtenden», der mit dem Sonnengott Helios gleichgesetzt wird. Das heisst, es gibt bei ihr das Moment des Irdischen, Vergänglichen, und das Moment des Göttlichen, des Lichts. Diese innere Spannung oder sogar Zerrissenheit hat mich fasziniert.
Wie ist der musikalische Charakter dieses ersten Teils?
Der Grundzug ist lyrisch. Hier steht die melodische Linie im Vordergrund, Kantabilität als Symbol des Menschlichen. Es hat etwas Ergreifendes, wenn sie von ihrem Schicksal erzählt.
Und die zweite Phase?
Hier erscheint die Sibylle als enttäuschte Rebellin und wird sehr emotional. Sie sagt: «Ihr hört nicht auf meine Worte und nennt mich eine rasende Lügen-Sibylle – ich warne euch!»
Und dann explodiert das Ganze.
Der dritte Teil des Textes führt uns in eine ganz andere Dimension. Das ist die Phase der Ekstase und der Höhepunkt des Werks. Die Sibylle gerät in einen Zustand, in dem sie sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Sie verliert ihre persönlichen Charakterzüge, wird zum Sprachrohr übernatürlicher Kräfte und sieht schreckliche Dinge. Hier ist in der Musik alles zerrissen, zerhackt; das mit ihren menschlichen Empfindungen verbundene Kantable ist weg, das Geräuschhafte überwiegt. Danach verstummt sie; sie ist entsetzt über das, was sie sieht, und die Musik stockt. Es herrscht eine Leere. Aber am Schluss kommt eine Wendung: Die Sibylle singt noch einmal: «Höret!» Die kantable Linie symbolisiert eine Rückkehr zum Menschlichen – ein Signal, das Rettung andeutet.
Das Wort «hören» kommt auffallend häufig vor.
Ich verstehe Oracula Sibyllina als eine Komposition über das Hören: Hören als Zuhören und als Symbol für das konzentrierte Erleben der inneren und äusseren Wirklichkeit, als umfassende Aufmerksamkeit für die Welt, die uns geschenkt ist und die wir nicht zerstören dürfen.
Mit diesem Stück hast du auch das Porträt einer unglaublich komplexen Frauengestalt gezeichnet.
Sie ist ein Medium, das zwei Seiten hat: eine menschliche und eine, die wir nicht verstehen.
Eine Art weiblicher Archetypus mit allen Widersprüchen.
Vielleicht.
Aus dieser inneren Gespaltenheit resultiert auch der dramatische Charakter der Figur. «Oracula Sibyllina» ist als Monodram konzipiert. Hast du auch schon an eine szenische Aufführung gedacht?
Ja, natürlich. Gerade die Stimme mit ihren Abstufungen vom Sprechen über Sprechgesang bis zum hochexpressiven Gesang ruft nach einer szenischen Darstellung. Die Aufteilung des Orchesters in drei räumlich getrennte Gruppen unterstützt die Dramatik. Es wird zum Resonanzraum der Stimme.
Im dritten Teil eröffnen sich Dimensionen, die heute in der Musik selten anzutreffen sind. Die Sibylle beschreibt eine Apokalypse in Form eines kosmischen Kampfes der Sterne: «Gott liess sie kämpfen, und Luzifer lenkte die Schlacht.» Dieses Bild wird auch musikalisch unerhört packend dargestellt.
Es gibt existenzielle Gedanken der Menschen, die man nicht beschreiben kann. Deshalb lasse ich die Sibylle sprechen, beobachte sie von aussen und erfahre durch sie, dass da etwas Unfassbares geschieht. Sie kann das nur stammelnd beschreiben. Ich sehe, was mit ihr passiert, aber selbst wage ich nicht, in diese Bereiche einzudringen.
Trotzdem: Du bist die Komponistin und formulierst es.
Ich gebe nur eine Art Umriss des gewaltigen Geschehens.
Du hast darauf hingewiesen, dass die Sibylle auch eine lichte Seite hat. Aber abgesehen vom ersten Teil ist das doch eigentlich ein sehr schwarzes Stück. Alles läuft auf diesen dritten Teil zu, den Kampf der Welten.
Ich sehe das nicht als eine hoffnungslose Situation. Der Schluss ist offen und lässt auch der Hoffnung Raum. Aber ich wollte schon bis an die Grenze gehen, um den Ernst der Warnung zu unterstreichen.
Dein Werkkommentar von 2015 endet mit einem Vierzeiler: «Wer bist du, Sibylle, du Heimatlose? / Ich will dir beistehen / Auf deinem Weg der unendlichen Suche / Bei deiner Flucht vor der Dunkelheit.» Du identifizierst dich offensichtlich stark mit dieser Figur.
Das Dilemma, in dem sie steckt, hat mich mitgenommen: Sie ist eine sehr feinfühlige Person, die die Welt differenziert wahrnimmt, und zugleich trägt sie die schicksalshafte Last, Dinge sehen zu müssen, die die anderen nicht sehen, und wird dabei nicht ernst genommen. Sie will etwas sagen, aber niemand hört zu, und so wollte ich mit ihr mitfühlen. Als ich den Apokalypse-Teil komponierte, war ich völlig erschlagen, auch körperlich. Das hat mich sehr viel Energie gekostet. In dieser Musik gibt es nichts umsonst.
Der Aspekt der Kommunikation ist dir offenbar sehr wichtig.
Wenn ich mich mit so einem Text beschäftige, dann möchte ich damit natürlich auch etwas sagen. Ich habe ein Bedürfnis zu sprechen, meine Position klarzumachen als ein heute lebender Mensch. Das gilt sicher für alle, die künstlerisch tätig sind.
«Oracula Sibyllina» entstand 2014–15 und wurde am 21. Mai 2015 in Winterthur uraufgeführt. Im Vergleich zu heute schien damals die Welt fast noch in Ordnung. Seither haben sich viele Probleme zugespitzt. Wie kommt es, dass du in einer noch relativ ruhigen Zeit ein Stück mit einer so katastrophischen Tendenz geschrieben hast?
Die Gestalt der Sibylle hatte mich damals schon jahrelang beschäftigt. 2003 spielte das Quartet noir beim Lucerne Festival meine komponierte Improvisation mit dem Titel Weissagung, in der auch schon einige Sätze des jetzigen Textes vorkamen; die Kontrabassistin Joëlle Léandre hat damals die Wildheit der Sibylle grossartig zur Darstellung gebracht. Das arbeitete in meinem Hinterkopf weiter. Und dann beobachte ich auch seit vielen Jahren die beunruhigenden Veränderungen in der Gesellschaft und im Zusammenleben, und die haben in den letzten Jahren zugenommen. Das waren so kleine Mosaiksteinchen, die sich langsam zu dem Bild zusammensetzten, das dann mit in die Komposition einfloss.
Fünf Jahre später, mitten in der Coronakrise
Bei der Uraufführung wurde «Oracula Sibyllina» noch vorwiegend als rein ästhetisches Ereignis wahrgenommen. Und jetzt, fünf Jahre später, stecken wir mitten im Desaster der Coronakrise und haben das Gefühl: Die Schreckensvision dieser Sibylle geht uns etwas an.
Ich muss sagen, manchmal staune ich selbst, dass sich meine Ahnungen oder Vorstellungen nach längerer Zeit verwirklichen. Das bestätigt mich in der Ansicht, dass wir Menschen zwar gewisse Entwicklungen intuitiv oder vielleicht sogar rational erkennen, aber nicht wahrhaben wollen, dass sie real existieren. Wir haben immer geglaubt, wir könnten alles erklären und damit die Welt beherrschen, und haben übersehen, dass es Bereiche im Menschen gibt, die völlig irrational sind. Diese Bereiche treten gerade bei der Sibylle hervor, wenn sie weissagt. Und das ist auch der Punkt, wo die Kunst ansetzen kann, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die Stimme der Sibylle, die zur inneren Stimme unseres Gewissens geworden ist, kann uns dabei leiten.
Die unerwartete Aktualität dieses Werks erinnert mich von ferne an die Geschichte von Gustav Mahler, der in einem glücklichen Lebensabschnitt die «Kindertotenlieder» schrieb, und drei Jahre später ist seine Tochter gestorben. Verfügen Künstler über einen siebten Sinn?
Wenn das so ist, dann hängt es vielleicht mit der Arbeitsweise des Künstlers zusammen. Er konzentriert sich monate- und jahrelang auf sein Werk, und das schärft die Wahrnehmung auf extreme Weise. Wenn ich komponiere, empfinde ich alles viel intensiver, auch die alltäglichen Dinge. Ich höre intensiver, ich verstehe die Menschen intensiver. Es findet eine Öffnung des Herzens und des Denkens statt. Und dadurch sieht man vielleicht auch weiter in die Zukunft als andere Menschen. Ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin besitzt die Fähigkeit, die Welt so intensiv wahrzunehmen und Anteil an den Veränderungen zu nehmen. Vieles, was ich als Zeitgenossin so erlebe, beschäftigt mich unglaublich stark, und die Musik ist das Medium, in dem ich meine Empfindungen mitteile.
Damit kommen wir zur heute viel diskutierten Frage: Sollen sich künstlerisch Tätige in gesellschaftlichen Fragen engagieren?
In jedem Fall, absolut. Mit dem, was man etwas verengt «politische Musik» nennt, habe ich zwar meine Schwierigkeiten, aber ein Realitätsbezug kann auf vielerlei Arten entstehen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen: Ja so ist es, und man kann nichts machen. In mir brennt etwas, ich möchte etwas bewirken mit meiner Musik und etwas verändern. Ich finde, nur durch starke Stimmen kann etwas in Bewegung gebracht werden. Deshalb beeindruckt mich auch diese Sibylle. Sie geht bis an ihre Grenzen und riskiert viel dabei. Damit ermöglicht sie, dass nach den Prophezeiungen, die sich schon oft so schrecklich erfüllt haben, am Schluss wieder das Licht kommen kann.
Sollte eine Komponistin oder ein Komponist direkt auf die Coronaproblematik reagieren?
Einer meiner Studierenden hat mich auch schon gefragt, ob ich nicht das Bedürfnis habe, ein solches Werk zu schreiben. Das scheint mir aber jetzt noch zu früh, und ich glaube nicht an so einen Reflex auf Knopfdruck. Wir sind noch mittendrin und machen Erfahrungen, die erst verarbeitet werden müssen. Wir brauchen Zeit zur Reflexion. Doch es ist absolut nötig, sich über kurz oder lang mit diesem beispiellosen Geschehen künstlerisch auseinanderzusetzen.
Was sind, von den materiellen Folgen einmal abgesehen, die Auswirkungen der Coronakrise auf den einzelnen Künstler?
Kunst besteht aus dem Austausch, sie ist ein Kommunikationsakt. Wie für alle anderen ist es für mich wichtig, dass ich mit dem Zuhörer und der Interpretin kommunizieren kann, und das geht im Moment nicht. Corona wird natürlich irgendwann vorbei sein. Aber ich betone nochmals das Moment der Reflexion, denn nur so können wir auch die Konsequenzen daraus ziehen und entsprechend reagieren. Das Schlimmste wäre, zu denken: Jetzt ist alles vorbei, und wir können weitermachen wie zuvor.
Was würdest du dir für das Nachher wünschen?
Dass wir unsere Egoismen überwinden und mehr aufeinander hören. Dass wir mehr Sensibilität entwickeln den anderen Menschen gegenüber, auch gegenüber den Nächsten, und uns freuen über das, was uns geschenkt ist, über die ganze Gegenwart, in der wir leben. Dass wir wieder schätzen lernen, was wir haben, und nicht nur an das denken, was wir noch nicht haben oder noch erreichen wollen.