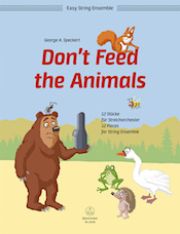Die Idee, eine Vorstellung mit verschiedenen Auftritten zu bestreiten, gibt es in der Geschichte der Unterhaltung seit eh und je und in allen Künsten. Das «Hauptgericht» wird garniert, um dem Publikum mehr für sein Geld zu bieten, um Übergänge zu «möblieren». Den Künstlern gibt das die Gelegenheit zu experimentieren und mit Kurzformen umzugehen. Denken wir nur an die Intermezzi, eingestreut in Opernaufführungen, aus denen schliesslich die Opera buffa hervorging, die Potpourri-Konzerte des 19. Jahrhunderts, die Curtain raisers des viktorianischen Theaters oder in jüngerer Zeit Varieté-Abende. Bei Auto- und Pferderennen spricht man von Undercards, beim Boxen von Vorkämpfen.
All das dient dazu, das Publikum gleichzeitig warten zu lassen und in Stimmung zu bringen, es «vorzuwärmen« für die Hauptattraktion. Es hält die Kosten der Veranstalter in Grenzen, die Anfängern eine vielbeachtete Plattform bieten, im Gegenzug aber sehr wenig oder gar nichts für deren Auftritt zahlen. Wenn nicht sogar die Auftretenden zur Kasse gebeten werden …
Wir haben einige Aussagen zum Thema zusammengetragen: «Du spielst sehr häufig gratis und musst all dein Material mitnehmen, weil der Hauptkünstler dir seins nicht leiht, dir aber nur fünf Zentimeter der Bühne überlässt», sagt Pilli, Sänger und Gitarrist der Gruppe Labradors, eine Band, die in Italien gerade aus der alternativen Szene herauswächst. «Manchmal ist es erniedrigend: Die Stars behandeln dich von oben herab, du spielst vor einem leeren Saal und das Ganze hilft dir in der Zukunft in keiner Weise weiter. Wenn du darüber hinaus für den Auftritt bezahlt hast, ist es abscheulich. Zum Glück haben wir weder Manager noch Agentur, so können wir selbst bestimmen, für wen wir spielen und zu welchen Bedingungen. Es ist immer besser, wenn du als Vorgruppe einer Band auftrittst, die du magst und die sich im persönlichen Umgang als freundlich herausstellt.»
«Wir haben Sen Dog, den Rapper von Cypress Hill, eingeladen, als Gaststar bei einem unserer Titel mitzumachen», erzählt Ignacio Millapani, Bassist von CardiaC, einer bekannten Genfer Hardcore-Metal-Band. «Sen Dog hat daraufhin versprochen, ein Wort bei der Produktionsfirma einzulegen, um uns als Vorgruppe von Cypress Hill bei einigen ihrer Konzerte in Europa unterzubringen. Und er hat Wort gehalten. Er hat seinen Einfluss beim Veranstalter spielen lassen. Dieses Vorgehen ist aber eher ungewöhnlich, denn normalerweise platziert das Label dort Gruppen, die es unter Vertrag hat. Sen Dog hat seine Stellung genutzt, um Druck zu machen. Da wir aber als unabhängige Band auftraten, mussten wir uns auch allein um die Logistik unseres Materials kümmern, grosse Schwankungen bei der Gage in Kauf nehmen – und dem guten Stern, der uns diese Möglichkeit gegeben hatte, immer schön dankbar bleiben. Trotzdem war es eine sehr interessante und nützliche Erfahrung: Wenn du vor 3000 Leuten spielst, achtest du auf jedes kleinste Detail, was einen Qualitätssprung zur Folge hat. Und du lernst mit der technischen Einrichtung grosser Bühnen umzugehen. Die Tonmeister dort spielen in einer ganz anderen Liga, du kannst dich also über einen genialen Sound freuen. Und schliesslich ist es eine ganz gute Schule, vor einem Publikum zu spielen, das keine Lust hat, dich zu hören, das du aber doch aufwärmen musst. Es bringt dich dazu, wirklich alles zu geben.»
«Bei meinen Erfahrungen mit Eröffnungsauftritten habe ich Glück gehabt: Bandleader und Dirigenten wie Eddie Gomez oder Giovanni Sollima haben mir als Auftakt ihrer Konzerte ihre Ensembles überlassen, um meine Kompositionen auszuprobieren», berichtet Maurizio Berti, Schlagzeuger, Pianist und Komponist. «Ich habe für sehr herablassende Stars des italienischen Pop eröffnet, die sich mit dem Helikopter einfliegen liessen. Viele Leute in diesem Zirkus machen dir das Leben schwer, einige sind wirklich widerlich; wir kennen das alle in diesem Beruf. Wichtig ist, was du am Ende davon hast: der rein musikalische Gewinn, der Kontakt, den du zu den Künstlern aufbauen kannst und was du von ihnen lernst.
In diesem Zusammenhang möchte ich erzählen, was ich als Eröffnungsnummer für Jason Rebello erlebt habe. Ich schätze ihn sehr, und vor ihm aufzutreten, schüchterte mich ein. Er ist mit Sting, Jeff Beck und allen Grossen auf der Bühne gestanden. Ich wollte das Konzert am Klavier beginnen, mit einem Trio und fast ausschliesslich eigene Kompositionen spielen. Wir waren dann vor der Vorstellung am Essen und mir war gar nicht wohl bei der Sache. Ich war nicht sicher, ob ich mich richtig vorbereitet hatte. Ich floh aus dem Restaurant und begann im Theater mit Übungen, die man so macht, um sich aufzuwärmen vor einem Auftritt – wie ein Schüler, der am Morgen vor dem Unterricht noch schnell die Aufgaben von jemandem abschreibt. Plötzlich kommen Leute. Ich höre auf und tue, als würde ich meine Noten vorbereiten. Jason Rebello kommt zu mir, nimmt mich zur Seite. Er hatte begriffen, was in mir vorging. Er sagt mir: ‹Warum hast du aufgehört? Mit hat das gefallen. Du solltest dich nicht genieren, deine eigene Musik zu spielen. Und du solltest keine Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Wir haben diesen Beruf gewählt, weil wir ihn lieben und weil er uns weiterbringt. Warum sonst? Ich habe mir früher auch Sorgen gemacht, ob ich gut genug vorbereitet sei, bis ich bemerkt habe, dass das nicht so wichtig ist, dass mich diese Sorge sogar ablenkt. Du hast nicht genug geübt? Morgen wird es besser gehen und in ein paar Wochen erst recht. Aber jetzt musst du auftreten. Wenn du Fehler machst, spielt das keine Rolle. Kaum jemand wird es merken. Und manchmal öffnen die Fehler ja auch Türen zu etwas Neuem, Interessantem. Darum: Spiel einfach, geniess es und freu dich!›»