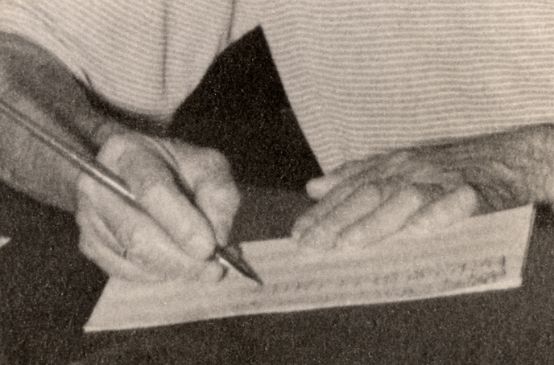TapTab Musikverein erhält mehr Geld
Der Regierungsrat und der Stadtrat Schaffhausen haben kulturelle Leistungsvereinbarungen erneuert. Die Beiträge an den TapTab Musikverein und das Kulturzentrum Kammgarn werden erhöht.

Der Musikraum TapTab erhält von der Stadt neu jährlich 25‘000 Franken (bisher 10‘000 Franken). Mit diesen Erhöhungen werde ein gezielter Beitrag an die Konsolidierung des Betriebs geleistet und die Konkurrenzfähigkeit des für die Region wichtigsten Kulturzentrums gestärkt, schreibt der Kanton. Die kantonalen Beiträge an den Musikraum TapTab (20’000 Franken), den Verein Kumpane (26’000 Franken) und den Verein Haberhaus Bühne (25’000 Franken) bleiben unverändert.
Die Vereinbarungen gelten von 2019 bis 2023 mit dem Verein Kultur im Kammgarn und dem TapTab Musikverein sowie von 2019 bis 2022 mit dem Verein Kumpane und dem Verein Haberhaus Bühne.
Die bisherigen Leistungsvereinbarungen zwischen dem Kanton und der Stadt Schaffhausen auf der einen Seite und den Leistungserbringern auf der anderen Seite hätten sich bewährt, heisst es in der offiziellen Mitteilung. Bei den erneuerten Leistungsvereinbarungen handelt es sich denn auch um bereits seit mehreren Jahren bestehende Verträge.
Schon seit längerer Zeit sei zudem bekannt gewesen, dass die finanzielle Unterstützung zugunsten des Kulturzentrums Kammgarn im Verhältnis zu seiner überregionalen Bedeutung nicht mehr angemessen sei. Daher haben sowohl der Kanton als auch die Stadt Schaffhausen ihre Beiträge erhöht. Der städtische Beitrag an Kultur im Kammgarn steigt von 70‘000 Franken auf neu 110‘000 Franken pro Jahr, die Unterstützung des Kantons steigt von 90’000 Franken auf neu 100’000 Franken pro Jahr.