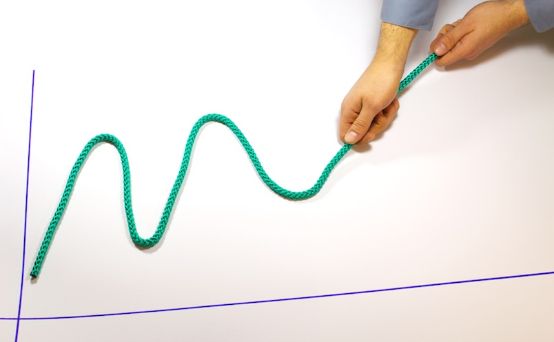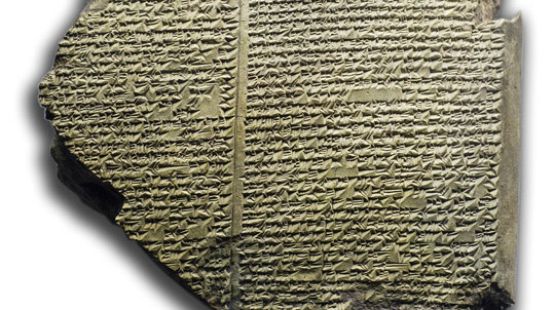Maria – greifbar und entrückt
In der frisch renovierten Klosterkirche wurden die Rheinauer Konzerte mit der Uraufführung von Ulrich Gassers Oratorium «Exvoto – ein Magnificat» Mitte Juni wieder aufgegriffen.

Die Täfelchen entdeckt man nicht sogleich. Der Besucher ist zuerst einmal überwältigt von der barocken Pracht dieses Kirchenraumes, der seit der abgeschlossenen Renovation in den leuchtendsten Farben erstrahlt. Beim Rundgang findet man sie dann im linken Seitenschiff an einer Wand. Abgebildet ist meist der heilige Fintan, der im 9. Jahrhundert als Mönch im Kloster Rheinau lebte, begleitet von Texten wie diesem: «Herr Conrad Götz von Reinach Offizier bey der französischen Prinzen Armee ist den 18. December 1793 beym Volken-Bach mit seinem Pferd über den Berg hinabgestürzt; doch aber samt dem Pferd durch ein Wunderwerk vom heiligen Fintan unverletzt erhalten worden.»
Diese Votivtafeln, mit denen gläubige Christen in früheren Zeiten für die Errettung aus einer Notsituation dankten, führten zu einer der drei Grundideen, aus denen der in Rheinau wohnhafte Komponist Ulrich Gasser sein Oratorium Exvoto – ein Magnificat aufbaut. Die zweite Grundidee beruht – der Titel spricht es an – auf dem Lobgesang Marias. Gasser hat seine Komposition nämlich zur Wiedereröffnung der renovierten ehemaligen Klosterkirche Rheinau geschrieben. Und diese ist Maria geweiht, wie man aus den zahlreichen Mariendarstellungen im Kirchenraum unschwer erkennen kann. Das dritte Element stellt der Rosenkranz dar. Die heutzutage weitgehend verschwundene, aber in Rheinau immer noch gepflegte Gebetsform ist eine Art von Meditation, die das Leben Christi aus der Perspektive seiner Mutter Maria betrachtet. Dass der Protestant Ulrich Gasser in seinem Oratorium mit Heiligen- und Marienverehrung derart katholische Themen aufgreift, mag einigermassen erstaunen. Gegensteuer aus reformatorischem Blickwinkel geben da die Texte von Gassers Ehefrau Eva Tobler, die die traditionellen Gebete da und dort mit aktualisierenden Paraphrasen anreichern.
Klangzeitraum
Auch das musikalische Konzept des Oratoriums ist untrennbar mit den räumlichen Gegebenheiten der Klosterkirche verbunden. Die Uraufführung unter der Gesamtleitung von Peter Siegwart zeigte diesen Aspekt in eindrücklicher Weise. Beteiligt waren das von Siegwart geleitete Vokalensemble Zürich, der Bach-Chor Konstanz (Leitung: Claus G. Biegert), der Cäcilienchor Rheinau (Leitung: Gesuè Barbera), der Brass-Band-Posaunenchor Marthalen (Leitung: Daniel Jenzer) sowie ein Streichtrio, ein Horn, ein Glockenspiel, eine Harfe und drei Orgeln. Die grosse Orgel hinten auf der Empore und die Chororgel vorne steckten dabei nicht nur den Rahmen ab, sondern setzten sich in ihrer mitteltönigen Stimmung auch von den temperiert gestimmten Blasinstrumenten und den Chören ab. Ausgeklügelte räumliche Effekte ergaben sich insbesondere durch das Vokalensemble Zürich, das abwechselnd vor dem Hochaltar, vor dem Chorgitter, im Kirchenschiff, auf den Seitengalerien oder auf der Orgelempore zu hören war. Wechselnde Standorte nahmen auch das Streichtrio und einzelne Musiker der Brass-Band ein. Die räumliche Gestaltung verdeutlichte in nachvollziehbarer Weise die unterschiedlichen textlichen und formalen Teile des Oratoriums.
Ulrich Gasser breitet in seinem Werk, wie er selber sagt, einen «Klangzeitraum» aus, den die Hörer selber ausfüllen müssen. Seine Musik fliesst in gemächlichem Tempo dahin, wiederholt sich oft, hat einen statischen Charakter, bietet eine flache Spannungskurve und lädt so zur Meditation ein. Immer wieder sind schöne Durakkorde zu hören, die an den Strahlenkranz von Maria auf einem der Altarbilder erinnern. Den vertrauten Klängen stehen aber auch verfremdete gegenüber, die durch verschiedene «Modi» wie Pentatonik oder Zwölftonreihen entstehen. Der Wohlklang wird überdies durch die überlagerten Stimmungen gestört. So spiegelt Gasser in der Harmonik genau die Doppelgestalt Marias, die auch in den Texten des Werks aufscheint: Sie ist eine zugleich greifbare und doch unendlich entrückte Erscheinung.