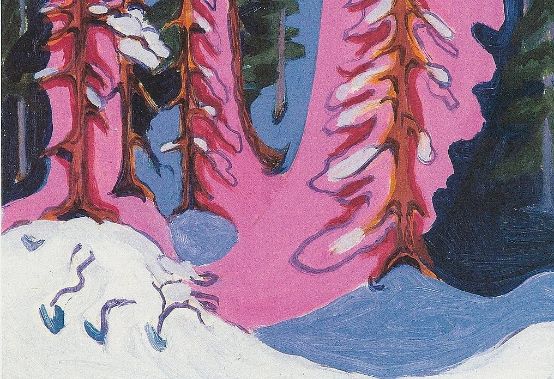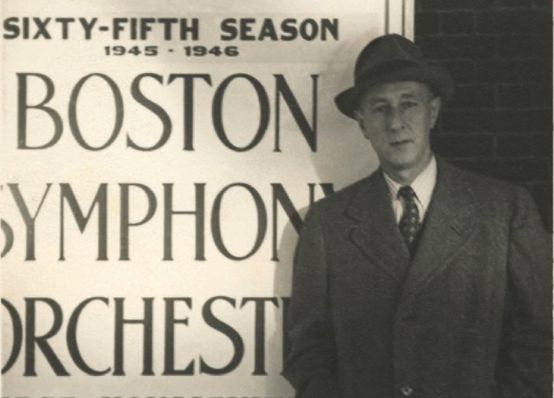Aus für Interjurassische Kulturkommission
Die Regierungen der Kantone Jura und Bern haben beschlossen, eine interkantonale Vereinbarung aufzuheben, die als rechtliche Basis für die gemeinsame interjurassische Kulturkommission diente.

Die gemeinsame Kulturkommission war für die Kulturpolitik in der Region zuständig und hat in den vergangenen zehn Jahren insbesondere Weiterbildungs-Stipendien an französischsprachige Kulturschaffende aus der Region vergeben. Die Kommission wird ihre Tätigkeit auf Ende August 2015 einstellen. Ihre Aufgaben übernehmen die besonderen interjurassischen Kulturkommissionen.
Die Kommission wurde 2005 von den Kantonen Bern und Jura gegründet, um «kulturelle Aktivitäten mit interjurassischer Ausstrahlung zu fördern». Die Kommission befasste sich namentlich mit Fragen, die ihr von beiden Kantonen im Nachgang zu Resolutionen der Interjurassischen Versammlung unterbreitet wurden. Im Weiteren hat sie die Entwicklung und Unterstützung der gemeinsamen Kulturinstitutionen evaluiert, Möglichkeiten für den Bau neuer kultureller Infrastrukturen untersucht und Weiterbildungs-Stipendien an Kulturschaffende aus der Region vergeben. Schliesslich diente die Kommission den politischen Behörden als beratendes Organ.
Für die Regierungen der Kantone Bern und Jura hat die interjurassische Kulturkommission zur kulturellen Annäherung der beiden Regionen beigetragen. Sie verdanken das Engagement der Kommissionsmitglieder. In den Jahren 2013 und 2014 haben die Kantone Bern und Jura gemeinsam neue Aufgaben für die Kommission gesucht. Als Folge von politischen Entscheiden in beiden Kantonen konnten konkrete Projekte allerdings nicht umgesetzt werden.
Das Ergebnis der regionalen Abstimmung vom 24. November 2013 im Berner Jura zum Einleiten eines Verfahrens zur Gründung eines neuen, aus dem Berner Jura und dem Kanton Jura bestehenden Kantons, hat die jurassische Kantonsregierung bewogen, auf die gemeinsame Kulturkommission zu verzichten. Am 16. Juni 2015 hat der Regierungsrat des Kantons Jura die Vereinbarung über die gemeinsame Kulturkommission gekündigt. Die bernische Kantonsregierung fasste den entsprechenden Beschluss am 1. Juli 2015.
Die interkantonale Kommission der szenischen Künste und die interkantonale Literaturkommission sind von diesem Entscheid nicht betroffen. Sie stehen mit ihrem Expertenwissen weiterhin beiden Kantonen zur Verfügung. Die laufenden Geschäfte werden von den Kulturämtern beider Kantone übernommen.