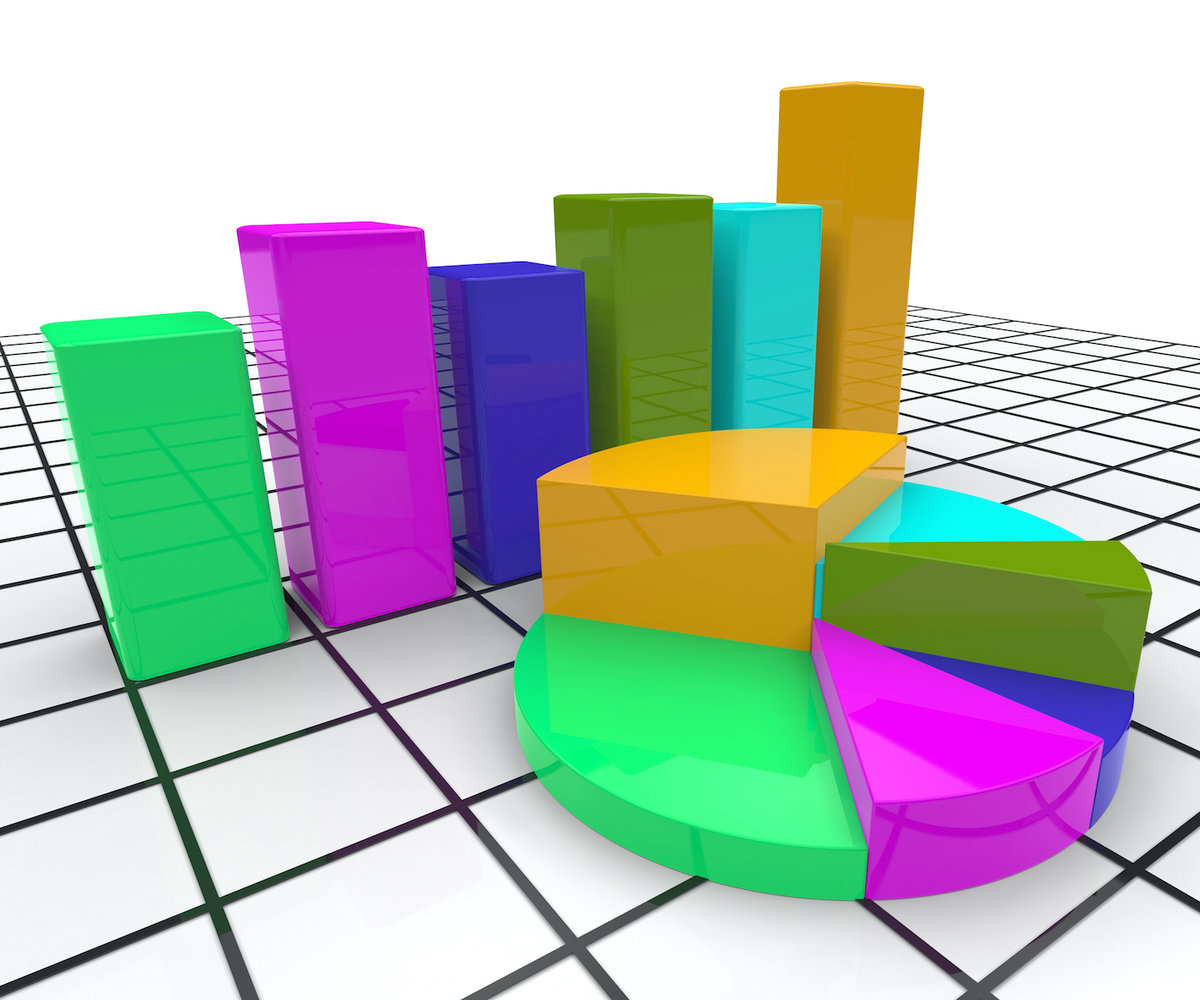Delacostes Bestände in der Walliser Musikbibliothek
Der Walliser Komponist François-Xavier Delacoste hat 2018 seine Werke in der Mediathek Wallis-Sitten deponiert. Um auf diesen bedeutenden Bestand, aufmerksam zu machen, veröffentlicht die Mediathek Wallis eine illustrierte Publikation.

Der 1950 in Monthey geborene François-Xavier Delacoste studierte am Konservatorium Lausanne, später Genf. Er spezialisierte sich auf Orchestrierung, Orchesterleitung und Komposition. Am Konservatorium Genf unterrichtete er Harmonielehre, Kontrapunkt und Analyse. Von 1989 bis 2005 leitete er das Konservatorium Neuenburg. Ausserdem besorgte er die künstlerische Leitung des internationalen Festivals für Chormusik in Neuenburg. Von 2005 bis 2015 leitete er das kantonale Konservatorium Sitten.
Mit der Unterstützung der Walliser Delegation der Loterie Romande entwickelt die Mediathek Wallis seit 2003 die Walliser Musikbibliothek. Sie konserviert bis heute über 17’000 Aufzeichnungen, 24’000 Partituren sowie 1’200 Werke und audiovisuelle Träger. Der 2018 ins Leben gerufene Bestand François-Xavier Delacoste ist nach Pierre Mariétan im Jahr 2005, Jean-Luc Darbellay 2009, Jean Daetwyler 2013, Marie-Christine Raboud-Theurillat 2016 und Oskar Lagger 2018 der sechste, der in der Mediathek Wallis deponiert wird.