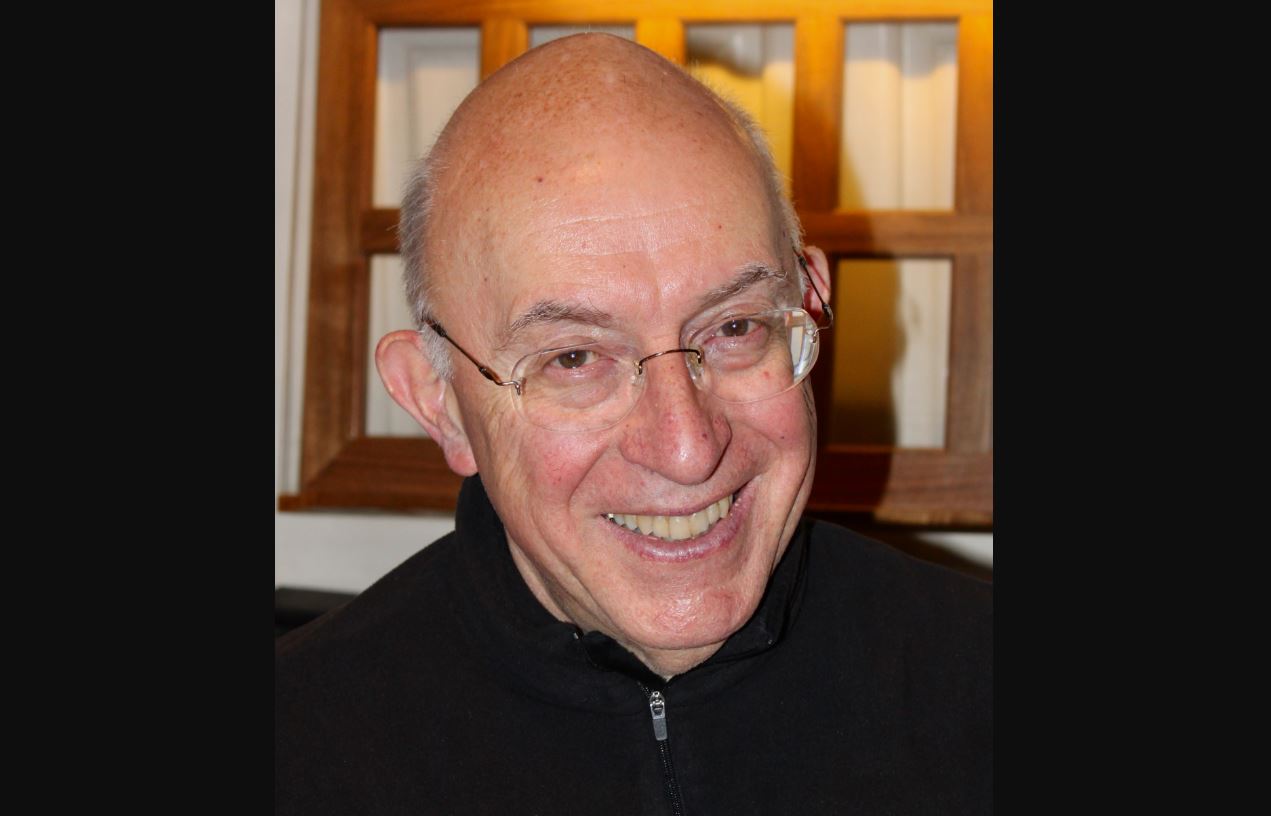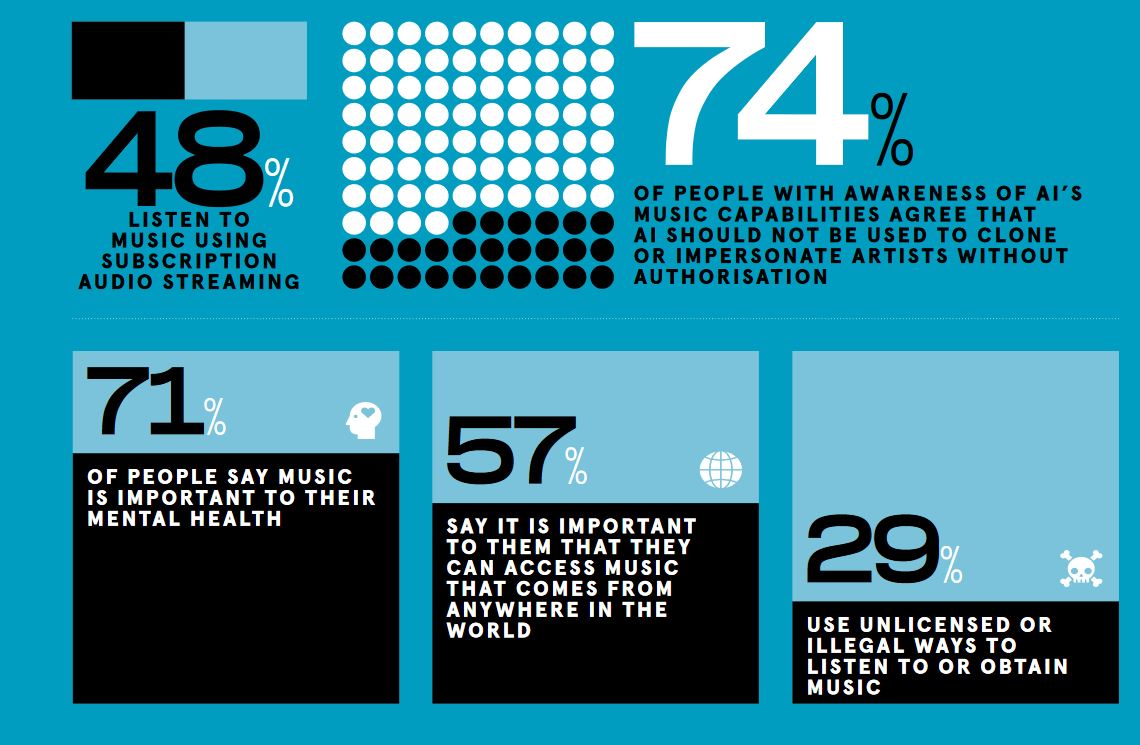Wenig Nachhaltigkeit im klassischen Musikbetrieb
Orchester, Ensembles und Konzerthäuser beschäftigen sich zunehmend mit Nachhaltigkeit. Das Potsdamer Research Institute for Sustainability bleibt kritisch.

Im Rahmen einer Studie führte ein Team des Potsdamer Institutes Interviews mit 25 Mitgliedern eines deutschen Orchesters. Es analysierte 13 Interviews, die auf dem Blog des Orchesters des Wandels – einer etablierten Nachhaltigkeitsinitiative – erschienen sind, und verglich die Aussagen mit sechs Diskursbeispielen, wie öffentlichen Deklarationen, Positionspapieren und Projektbeschreibungen von Institutionen.
Dabei stiess das Team auf ausgeprägte Beharrungskräfte: Sowohl Musikerinnen und Musiker als auch Institutionen zeigten nur an ausgewählten Aspekten nachhaltiger Entwicklung Interesse und übten kaum Kritik an gängigen Verhaltensweisen in der Branche. Die historisch etablierten Werte der Exzellenz und der Bewahrung eines als unbeweglich verstandenen kulturellen Erbes erzwängen das Beibehalten der Spielregeln und behinderten praktische Schritte zur Entschleunigung des Konzertbetriebes, so das Fazit der Forschenden.