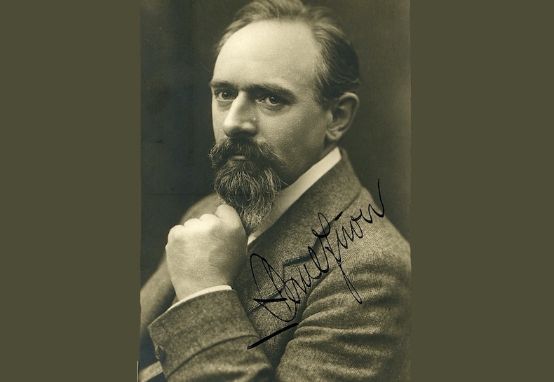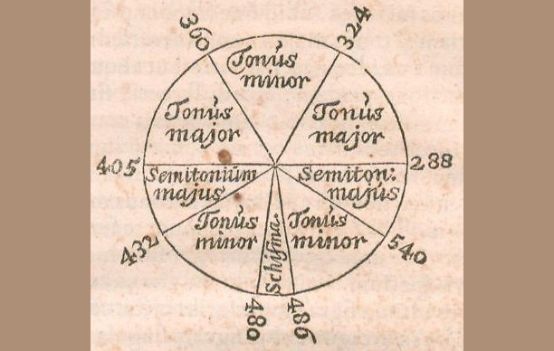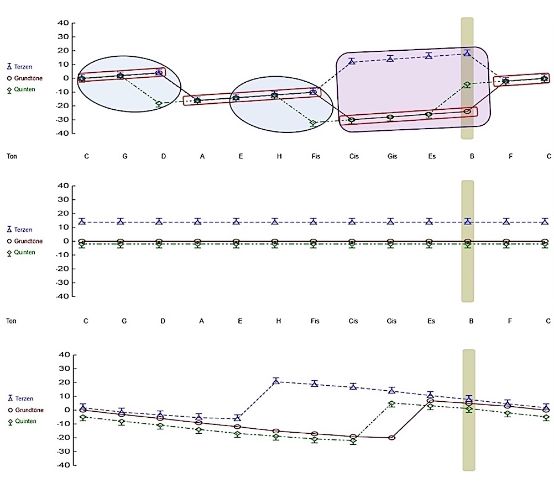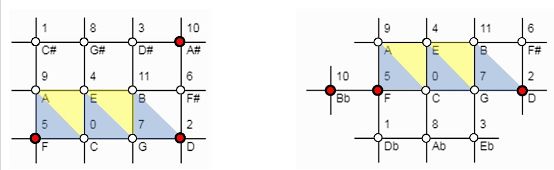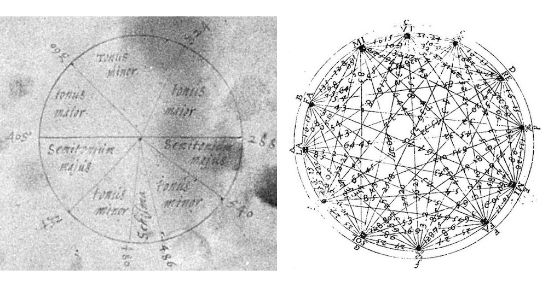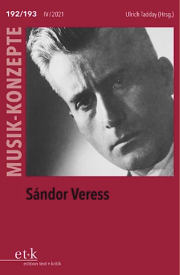Auf meine Umfrage auf Facebook sind so viele Reaktionen zurückgekommen, dass ich unmöglich alle im gedruckten Artikel zitieren konnte – erst recht nicht in der Länge, in der sie bei mir eingetrudelt sind. Natürlich hatte ich auch ein schlechtes Gewissen: So viel Gedankenarbeit und Mühe darf nicht unbeachtet bleiben! Darum hier eine ausführliche Auswahl der Beiträge. Allen Beteiligten: tausend Dank!
Anmerkung der Redaktion: Die Beiträge werden in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen veröffentlicht. Der O-Ton wurde beibehalten. Hinsichtlich Rechtschreibung und Zeichensetzung wurden meist die Editionsstandards der Schweizer Musikzeitung angewendet. Einige Emojis aus diesen Texten können hier leider nicht als Bilder angezeigt werden.
Andi Gisler
Ich halte es mit meinem Gitarren-Idol James Burton: «Dou you know music theory?»
«Yes but not enough so that it would hurt my playing.»
Die Diskussion um Autodidakt vs. Studium oder Notenlesen vs. «nach Gehör spielen» greift meist zu kurz, ausserhalb von klassischer Musik sind es ja meist bis immer «Mischformen» – ich hatte z.B einige Jahre Klassikgitarrenunterricht, alles andere aber «autodidaktisch» gelernt bzw. bin immer noch täglich dran. Notenlesen kann ich, habe es aber in der Praxis kaum bis nie gebraucht.
Aber viel wichtiger noch ist die Inspiration und der Einfluss von allen Gebieten ausserhalb der Musik. Nebst dem Leben und der persönlichen Erfahrung sind dies Bücher, Filme, Politik, etc. etc. In England z. B. war die Existenz von Art Schools absolut entscheidend für die Entwicklung der Popmusik. Und Pop/Rockmusik kann auch nicht getrennt von Mode, Politik, Gesellschaft betrachtet werden. Meines Wissens hat z. B. niemand bei Pink Floyd Musik studiert. Die Band entstand aber im Umfeld einer «akademischen» Umgebung – 2 oder 3 Mitglieder waren Architekturstudenten. Und dies hatte natürlich enormen Einfluss auf die Musik, die Präsentation, das Artwork, etc.
Vielleicht läuft Jazz Gefahr, durch die Akademisierung zum Elfenbeinturm zu werden. Wenn man aber die Entwicklung sieht, wie viele jüngere «Jazzers» z. B. Elektronik oder Hip-Hop verarbeiten, sehe ich eigentlich keine Gefahr.
Ich habe grad begonnen, die Doku über Keith Jarrett The Art of Improvisation auf YouTube zu schauen. Und als Erstes spricht er genau über dies: «Der Fehler ist zu meinen, Musik komme von der Musik her». Und ich glaube dies stimmt 100%. Als Musiker kommt man nicht drum, intensiv und gnadenlos zu üben. Aber das Befassen mit anderen Sparten kann kreativ äusserst inspirierend sein.
Betty Groovelle
Ja, ich bin auch Autodidaktin. Heisst aber auch vor allem, dass man eine eigene Sprache für Musik entwickelt, man entdeckt alles selber. So Sachen wie Dissonanz Harmonie, Form. Habe zum Glück ausserordentliche analytische Fähigkeiten, ein Engineering-Köpfchen. Was mich immer wieder gewundert hatte ist, dass immer wieder studierte Musiker nicht in der Lage waren, mir meine forschenden Fragen zu beantworten, warum etwas so oder so ist. Mir erschliesst sich auch nicht, warum man Improvisation üben muss, man hört doch, was für Töne passen und wo die Musik hinwill, dann sucht man sich aus, wie extreme und wie lange Umwege man dazu singt. So gibt es einige Sachen, wo ich viel Freiheit habe.
Denn diese wilde Musik mit orchestergrossem Ausmass war schon immer in meinem Kopf. In der Primarschule schon immer gelitten mit diesen Horrorliedern mit den immer gleichen Akkorden wie Hänschen klein, erst spät Jazz entdeckt … endlich etwas, das der Musik im Kopf eher entspricht. Ich bin Jazz, habe es aber nie gelernt. Nun mit dem Computer mit DAW lerne ich Schritt für Schritt, dass meine Musik aus dem Kopf raus kann und ich sie hören kann.
Bruno Spoerri
Ich habe – glaube ich – bis zum 30. Lebensjahr eine ziemlich typische Entwicklung durchgemacht wie fast alle meine Kollegen im Schweizer Jazz. Es gab ja keinerlei Jazzausbildung, und Jazz war verpönt – in Konservatorien war es zum Teil verboten, Jazz zu spielen. Es gab ein paar wenige Leute, die den Spagat wagten z. B. der Pianist Robert Suter, Pianist der Darktown Strutters und Klavier- und Theorielehrer am Konsi Basel.
Ich lernte als Kind Klavier, zuerst beim Pianisten des Trios meiner Mutter (sie war Geigerin und hatte ein Trio, mit dem sie im Cafe spielte – und gelegentlich trat sie als Solistin im Sinfonieorchester auf), dann beim Oberguru der Basler Klavierlehrer, der mir das Klavierspielen völlig verleidete. Immerhin lernte ich einigermassen Noten lesen. Dann begannen Freunde, Jazz zu spielen, und ich wollte mitmachen. Der einzige Platz, der frei war in der Band, war der des Gitarristen, und ich fragte einen Gitarrenlehrer, wie man das am schnellsten lernt. Er empfahl mir die Hawaiigitarre, und ich machte das eine Zeitlang, bis ich merkte, dass das wohl das falsche Instrument war.
Der Lehrer hatte noch ein altes Saxofon, und das verkaufte er mir. Ich kam dann zwei Jahre in ein Internat nach Davos, und dort gab mir der Saxofonist eines Tanzorchesters, Pitt Linder, die ersten richtigen Sax-Stunden, und er liess mich ein paar Swingstücke so lange spielen, bis ich begriffen hatte, wie man im Swingstil phrasiert. Wir hatten in der Schule auch ein Trio, mit dem ich viel übte. Zurück in Basel (1949) hörte ich jede Nacht AFN im Radio,Charlie Parker, George Shearing etc.
Erste Auftritte kamen im Tanzkurs, Jams im Atlantis mit den dortigen Pianisten (Elsie Bianchi, Gruntz, Joe Turner), dann die ersten Jazz Festivals. Der Pianist Don Gais lieh mir sein Book aus und ich schrieb etwa 100 Stücke von Hand ab. In Basel gab es Old style Bands (Darktown Strutters, Peter Fürst) und die Modernisten um George Gruntz. Ich spielte überall mit, machte 1954 die Matur und begann, Psychologie zu studieren. Dann kamen erste Preise im Festival, eigene Bands (Bigband), dann in Zürich beim Weiterstudium das Metronome Quintet. Und ich begann zu arrangieren, zu komponieren etc. – klare Idee war, als Psychologe zu arbeiten und nebenbei so viel wie möglich Musik zu machen. Dann hatte ich zwei Jahre lang Unterricht bei Robert Suter, und er brachte mir Harmonielehre und Kontrapunkt bei.
Dann heiratete ich 1960, lebte weiter das Doppelleben, und begann im Africana zu spielen. Dann kam ich durch Zufall zu einem kleinen Filmmusikauftrag für die Expo 64. Dadurch kam ich in Kontakt mit einer Werbeagentur, hatte noch ein paar Aufträge – und Ende 64 fragte man mich plötzlich, ob ich in eine neue Werbespot-Filmfirma eintreten wolle als Hauskomponist und Tontechniker. Ich machte den Sprung, obwohl ich eigentlich keine Vorbildung dazu hatte, und lernte dann in der Praxis, wie man das macht. Und dann kam ich in Berührung mit elektronischer Musik und mit sog. Beatmusikern (The Savages), Es war alles Learning by doing – bei jedem neuen Auftrag musste ich etwas lernen – dann auch technisch – u. a. weil ich mit den Tonstudios damals Probleme hatte, machte ich mein eigenes Studio auf, bis ich mit Eigenproduktionen auf die Nase fiel (Hardy Hepp, Steff Signer, etc.) etc. etc.
Ich meine, alle meine Kollegen hatten ähnliche Voraussetzungen: Unterricht bei Klavierlehrer, oder auch in einer Blasmusik – klassisch orientiert, dann selbst lernen vor allem zusammen mit Freunden, viel Spielen und alles ausprobieren. Gruntz war praktisch der Einzige, der vom Autoverkäufer zum Profi wurde – Ambrosetti und Kennel leiteten Firmen. Viele waren auch Studenten – von diesen gaben allerdings viele das Spielen nach dem Abschluss auf. Ich machte 1958 eine Umfrage (das war meine Diplomarbeit als Psychologe).
Noch ein Gedanke zur Jazzgeschichte: Schon früh gab es die Mär vom selftaught genius – die Original Dixieland Band warb damit, obwohl alle Musiker dort effektiv Musikunterricht hatten – man gab sich als Naturgenie, das war eine gute Werbung. Bluesmusiker waren allerdings öfter ohne Ausbildung – aber auch sie lernten vor allem durch den Kontakt mit älteren Musikern. Und im Rock wurde es auch zu einem Markenzeichen, dass man alles selber gelernt habe – was meistens auch nicht genau stimmt. Auf jeden Fall: zu dem Thema gibt es sehr viel idealisierte Lebensläufe …
Bujar Berisha
Es ist ähnlich wie ein Ausländer zu sein. Du lebst dasselbe Leben, isst dasselbe und machst auch etwa dasselbe nur ist die Sprache anders. Das schliesst aus oder weckt Neugierde. Und so wie alles, hat alles Vor- und Nachteile. Vorteil, du hast von Anfang an eine eigene Handschrift, die andere erst später sich erarbeiten müssen/wollen. Dafür erkennen Autodidakten am Anfang gar nicht ihre Handschrift, sondern sehen diese als Manko … Beispiel, manche hören sofort, dass die Geige schlecht gestrichen wird, obwohl sie keinen Ton in einer Tonskala orten können. Gelernte Violinistinnen und Violonisten brauchen unter Umständen Jahre, um dies zu hören, wie der Bogen die Saiten zum Schwingen bringt.
Christoph Gallio (DAY & TAXI)
Ich hab mir mit 19 Jahren ein Saxofon gekauft und mich autodidaktisch 2 Jahre durchgewurstelt (free Improv und Freejazz in Bands) … danach in 2 Jahren Notenlesen gelernt (Musikschule Basel bei Ivan Rot) und dann ein Jahr Konsi Basel (auch bei Iwan Roth). Und als ich 29 Jahre alt war dann 2 Nachmittage „Unterricht‘ bei Steve Lacy in Paris. Das wars dann mit Instrumentalunterricht. Als Komponist bin ich total autodidaktisch unterwegs.
In Basel war ich mit Philippe Racine (Flöte – heute Professor an der ZHdK, komponiert mehrheitlich, da er wegen einer Dystonie nicht mehr spielen kann) in ner WG. Er war vor mir am Konsi. Super begabt und wurde im Duo mit Ernesto Molinari als Neue Musik-Interpreten rumgereicht und gefeiert. Das ist ja schön und gut. Nur wurde man da als Freejazzer belächelt und auch nicht ernst genommen – das war so ne unausgesprochene Grundstimmung. Ein Mitstudent (auch Saxofonist!) am Konsi nannte mich damals Seelenverkäufer.
Ich hatte in der Freeszene (in Basel und Zürich) zu tun … danach dann sehr schnell mit der Jazzszene sympathisiert (was in der Freeszene wiederum nicht goutiert wurde – man war damals schnell ein Verräter. Kompliziert alles!). Die Freeszene wollte auch an den Topf der Neuen Musik, wollte genauso ernst genommen werden wie die diplomierten Neuetöner. Da gabs ja noch E und U Musik. Und «wir» wurden lange Zeit als U-Musiker (innen gabs wenige – ausser Irene) deklassiert. Warum? Weil wir halt nicht die Konsi-Mühlen durchlaufen haben. Kurz: Wenn man am Konsi war konnte man spielen. Wusste man wie Musik funktioniert.
Wir Freejazzer etc (wir verstanden uns als E-Menschen und waren alle Autodidakten – kann man ja nicht an ner Hochschule studieren) … zogs natürlich auch zu den gleichen Spielorten und Fördertöpfen. Diese mussten verteidigt werden. Es gab die MKS (Musikerkooperative – heute Sonart) und die war bemüht um die Akzeptanz der frei Improvisierenden. Damit auch wir an die Töpfe (auch die waren nie prallvoll!) rankamen. Diese Töpfe wurden aber sehr verteidigt und es brauchte Jahrzehnte, bis sich das ein wenig änderte. Und wenn Geld im Spiel ist, gehts auch schnell um Macht. Wer bekommt es, wer verteilt es. Wer ist Freund, wer nicht.
DAY & TAXI: Drummer Gerry Hemingway (67) ist totaler Autodidakt, ich (65) ja mehrheitlich auch und Bassist Silvan Jeger (37) hat natürlich einen Master im Bassspielen. Es gibt ja heute eigentlich gar keine Autodidakten mehr. Ohne Diplom kann man heutzutage nicht mehr an einer Musikschule unterrichten. Silvan hatte mal ne eigene Band, die ich ganz toll fand …war noch nicht ausgereift, aber auf dem Weg. Leider konnte er sie schlecht verkaufen, und die Mitglieder verhielten sich passiv (sehr normal – halfen nicht mit mit der Gigssuche etc), was ihn enttäuschte und nach nem Jahr gab er die Band auf. Leider null Durchhaltevermögen. Oder die Motivation war zu klein … es ging ihm zu langsam … keine Ahnung…
Anekdote: Unseren letzten Gig in Baden liessen wir aufnehmen. Der Techniker ist masterierter Jazz-Drummer und ca. 25 Jahre jung. Nach dem Gig – der ihm gefiel – fragte er mich nach meiner Ausbildung. Die Antwort kennst du. Und ich sagte ihm, dass Gerry (berühmt und ex Dozent Jazzhochschule Luzern) sogar ein totaler Autodidakt sei. Danach sagte er: OK, ich verstehs nun. Da ist was, dass ich so zum ersten Male höre oder das mich verunsichert. Es irritiert mich. Und er sprach von einer Energie. Ich glaube er spürte das Commitment, das innere Feuer oder so – na, das tönt jetzt doch sehr esoterisch …;-) … Auf jeden Fall hatte mich diese Episode erfreut. Zu merken, dass da ein junger Musiker was mitbekommt, das ihn verunsicherte, zum Nachdenken motivierte. Ich glaube er hat über Musik nachgedacht, was sie kann, was sie soll – oder ganz einfach übers Wie …
Daniel Gfeller
Musik ist die Krankheit, die man mit Musik zu heilen versucht. «War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?» (F. Kafka/Die Verwandlung). Man ist zur lebenslangen «Selbstverwirklichung» verdammt – mit oder ohne formale Bildung. Sogar die Dekonstruktion qua Punkrock ist gescheitert … hopeless. Wir sind stolz darauf, den eigenen Seelenklang zu finden, bis ein Lehrer, oder das Liebes(un)glück oder das Leben die zarten Triebe stutzt … Musik ist auch «Reviermarkieren» – wo ich klinge, bin ich. Formale Ausbildung nimmt einem die Last, dauernd selber absolute Instanz sein zu müssen (meine ich).
Daniel Schnyder
Jeder muss für sich selbst lernen, niemand kann etwas für jemand anderen lernen, deshalb ist per definitionem jeder kreative Geist ein lebenslanger Autodidakt.
Dieter Ammann und Bo Wiget (Dialog)
DA: Einer der Vorteile als Autodidakt ist, dass man Musik beurteilen darf nach dem Motto: Das gefällt mir … das gefällt mir nicht. Allerdings ist dies gleichzeitig auch ein Nachteil, denn tiefergehende Beurteilungskompetenz bleibt einem so verwehrt.
BW: Autodidakt sein heisst so wie ich das verstehe eigentlich nicht, dass man nichts weiss.
DA: Als jemand, der in Teilen kompletter Autodidakt war (Trompete, E-Bass), würde ich so etwas auch nie behaupten.
Emanuela Hutter, Hillbilly Moon Explosion
Ich lernte seit der Primarschule Klavierspielen. Nahm klassischen Gesangsunterricht in Zürich und New York. Das Gitarrenspielen eignete ich mir alleine an.
Dazu habe ich diverse unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Im Gesang musste ich früher, als ich noch klassisch sang, immer umschalten. Oliver von den Hillbillies ging jeweils fast die Wände hoch, wenn meine Stimme jeweils wegen Auftritten mit dem Klassischen Ensemble zu sehr in der Klassik feststeckte. Dort ist das Augenmerk immer auf der Resonanz. Und es wird intensiv am Klang der Vokale gearbeitet. Groove und Verständlichkeit kommen da zuweilen ins Hintertreffen. Der Vorteil: Ich kann 3 Wochen am Stück jeden Abend mit den Hillbillies auftreten ohne heiser zu werden und nach wie vor ohne Mic in einen Raum hinaus singen und viel Resonanz erzeugen, was die Zuschauer jeweils verblüfft.
Ich habe irgendwann gehört und beobachtet, dass meine Lieblingssängerinnen aus Blues und Jazz die Gestaltung ihres Klangs über die Konsonanten «abwickeln». Ich mache das jetzt auch so, was teils den aussergewöhnlichen Mix ausmacht bei den Hillbillies: meine klassisch geschulte Stimme und der Sound der Instrumente.
Was das Klavier betrifft, fällt mir jeweils auf, dass meine Art am Klavier Songs zu schreiben immer noch von den Stücken von Chopin, Grieg und Bartok beeinflusst und begrenzt werden, die ich vor langer Zeit mal intus hatte. Darum dieses altbackene Filmmusik Ambiente bei jenen Songs. Siehe oder höre hier:
https://www.youtube.com/watch?v=nF75w7yTY8c
Das Gitarrenspiel habe ich mir selbst angeeignet. Zum Songs schreiben. Und ab und wann mir Techniken von Gitarristen zeigen lassen, wie z.B. finger-picking. Ich nahm jedoch nie regelmässig Lektionen. Ich bin limitiert und spiele eine urchige Rhythmusgitarre, wobei ich mich freue, dass mein holziger Stil mittlerweile auch im Studio geschätzt und eingesetzt wird. Ja teils gar vorgezogen, und das obwohl ich mit Gitarrencracks zu tun habe, wie Joel Patterson oder Duncan James.
Beides, das seriöse Erlernen eines Instrumentes, wie das autodidaktische Aneignen hat Vor-und Nachteile.
Ernst Eggenberger
Ich bin Songwriter man findet mich auf Youtube. Ich hab in den 80ern mit einer Jazzrockformation Andromeda Konzerte und Platten gemacht. Die letzten 7 Jahre hatte ich das Glück, mit Felix Rüedi am Bass Konzerte und CDs aufzunehmen. Er hat die Jazz-Schule gemacht, ist ein versierter Fret und fretless bassist. Für die CD-Aufnahmen hat er mit meiner Vorlage jeweils die Charts für die Studiomusiker herausgeschrieben. Er sagte immer, es sei ein Glück, dass ich nicht geschult sei, denn sonst könnte ich nicht so freie Songs schreiben, ich kenne keine Regeln, also muss ich mich auch nicht daran halten. Er meinte immer in meinen Songs hätte es immer irgendwo eine Falle bei der Stelle er aufpassen müsse.
Ich hab auch mal einen TV-Auftritt mit der Kapelle Oberalp gehabt, die haben zwei Klarinettisten, einer hat das Konsi gemacht, der andere kann keine Noten lesen, und die spielen seit über 30 Jahren zusammen. Es kann immer alles Vor und Nachteile haben.
Ernst Hofacker
Als alter Wald-und Wiesen-Rock’n’Roll-Gitarrist sage ich: Als Autodidakt hab ich mir immer die nötige Unvoreingenommenheit der Musik und dem Instrument gegenüber bewahrt. Aber ein bisschen Unterricht, hier und da abgucken und der Wille zum vierten Akkord haben nicht geschadet! (Anm. Red. drei Gitarren-Emojis sowie 🙂 )
Hotcha Means Hotcha
In den 60ern waren wir alles Autodidakten, haben abgeguckt, wo wir konnten, Legenden erzählen von Gitarristen, die absichtlich mit dem Rücken zum Publikum spielten, damit man nicht sah, was sie machten, manchmal wurde uns auch von befreundeten Gitarristen etwas beigebracht, ich habe The Last Time vom Vater von Jessi Brustolin gelernt, auch Gloria und die Barrégriffe … das erklärt nämlich auch, warum aus Beat dann Krautrock und später Progrock entstand, ersteres unverkennbar immer wieder erstaunt über die geniale Pentatonik, die man rauf und runternudeln konnte, letztere unverkennbar mit einem verschrobenen Ehrgeiz unterwegs zu Augenhöhe mit den Klassikern.
Schon 1967 meinte unser Bassist aus gutem Hause zu mir, «Bach ist nur für intelligente Leute», war klar, was er damit sagen wollte … aber eben, das war die Saat. Danach, um Sax spielen zu können, musste ich Harmonien kennen und verstehen, darob bin ich heute froh, wo ich Youtube-Videos für Soundbytes-Schieber mit einem Fetisch für Vintage Elektronik sehe, wo man ihnen II-V-I erklärt
Jessi Brustolin
Mir hat mein Vater House of the Rising Sun beigebracht 🙂 Danach war das Buch von Peter Bursch angesagt, anstelle von Noten haben Zahlen Griffe erklärt. Dann tatsächlich ein paar Jahre Jazz-Unterricht, wobei der arme Lehrer an mir verzweifelt ist, ich wollte immer Punk- und Metal-Songs spielen anstelle von Robben Ford. Das ist bis heute so :-))
John C Wheeler (Hayseed Dixie)
Guitarre ja. Klavier nein. Ich wurde klassisch ausgebildet, allerdings kommt das mit Vorteilen und Nachteilen – hauptsächlich heisst das gut für die Technik, schlecht für den Groove.
John C Wheeler und Stephen Yerkey (Dialog)
SY: I’m self-educated… I want to write a memoir on what it’s like to play music for fifty-five years with your head up your ass.
JCW: In 3 years, I’ll be able to help you write it.
Jonathan Winkler
Hatte ein wenig Unterricht aber schliesslich das meiste durch Hören und Nachspielen gelernt – entsprechend limitiert bin ich … Bedaure manchmal schon, nie richtig gelernt zu haben, wie man Gitarre spielt.
Käthi Gohl Moser
Auch nach bald 50 Jahren unterrichten und Aufbau der musikpäd. Masterstudiengänge in BS: Es gibt kein Lernen, das nicht ausschliesslich im/in der Lernenden selbst passiert. Wir sind unter anderem Gärtner, können also für bessere (und leider auch schlechtere) Bedingungen sorgen, wir sind Spiegel für das Fördern der Eigenwahrnehmung, aber vor allem können wir anstecken und Musik/Feuer legen, aber brennen tun die Schüler selber … Fazit: Für fantastische Musik ist Ausbildung nie die einzige Voraussetzung. (Sternen-Emoji)
Kno Pilot
Ich bin weitgehend Autodidakt und halte das bei Indie-Liedermacher-Zeugs (was ich mache) für einen Vorteil. Letzte Woche spielten wir einen neuen Song (ich Bass und Gesang) und ich hörte in meinem Kopf einen «interessanten» Ton, den ich in die Basslinie einbauen wollte. Als ich ihn auf dem Griffbrett gefunden hatte wurde mir klar, dass es sich um die Oktave des Grundtons handelt :-)) . Ausgebildete Musiker würden das nie im Leben als interessanten Ton bezeichnen und ihn vielleicht nicht mal spielen, weil es zu simpel ist
Lukas Schweizer
Ich habe viele Jahre klassischen Gitarrenunterricht gehabt, streng nach Noten. Als ich mit meiner eigenen Musik begonnen habe, musste ich mich zuerst von den «starren» Nöten lösen lernen. Und ich habe erst beim freieren Spielen das System Gitarre richtig begriffen. Zuvor bin ich viel zu fest an den Noten gehangen. Weiter habe ich lange Zeit in Chören (vorwiegend klassische Chormusik) gesungen. Für meine eigene Musik musste ich meine Stimme neu entdecken, herausfinden, was mit ihr möglich ist und was mir gefällt. Auch hier ging es um einen freieren Umgang mit dem Instrument Stimme. Auch mir ist aber die recht fundierte musikalische Grundausbildung, die ich genossen habe, wichtig und die Basis für vieles. Beispielsweise bringe ich mir gerade selbst etwas Klavierspielen bei und da hilft mein musiktheoretisches Wissen schon.
Marc Unternährer
Ich habe klassisch studiert, während dem Studium schon improvisiert und (im weitesten Sinne) Jazz gespielt und brauchte Jahre nach der Ausbildung, um von gewissen Dingen frei zu werden und mich von Vorstellungen zu lösen, wie ich klingen soll und darf. Im Jazz lernte ich durch oftmalige Überforderung mehr und mehr dazu, da bin ich Autodidakt. Das Studium möchte ich nicht missen, heute spiele ich nicht mehr im streng klassischen Bereich.
Martin Söhnlein und Dieter Ammann (Dialog)
MS: Mit Profis hat man zwölf Töne – mit Amateuren alle.
DA: Das ist nicht ganz richtig – Mikrotonalität birgt viel mehr Töne …;))
MS: Da hast du natürlich recht.
DA: Und dann kommt in der zeitgenössischen Musik (was genremässig seit über hundert Jahren, seit dem Zusammenbruch der «Tonalität» als «Neue Musik» bezeichnet wird) noch die ganze Geräuschpalette dazu … Kunstausdruck kennt per se fast keine Grenzen.
MS: Total einverstanden. Der Weg – obwohl das Ziel – spielt da gar nicht mal so eine grosse Rolle.
Matthias Penzel
Meine Erfahrung, nicht anders als beim Auf-Den-Händen-Laufen: Wenn man sich was selbst beibringt, dauert es länger, z.B. auch das Trainieren des Gehörs – und es ist, so scheint mir, es ist dann auch immer viiiiel tiefer in Mark und Bein eingefräst. Denn man spielt dann, bspw. was so Läppisches wie einen 4/4 Takt, so, als hätte man den gerade erfunden. Das ist schwer zu lehren und auch anderen schwer zu vermitteln. Wenn du bei AC/DC (nicht mein Geschmack, sondern sachlich beobachtet) in der Konzerthalle siehst, wie die Leute bis in die echt allerletzte Reihe mitwippen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass keiner weiss warum, wenn du mit Drummern darüber sprichst, stösst du sofort auf eine Menge Drummer, die das ganz genau erklären können. Das Wie ist nicht so leicht zu unterrichten … bzw. konventionell unüblich; vielleicht gibt’s auch äh, ‘spirituellere’ Didaktik. Aber kaum am Konservatorium, nehme ich an.
DANN gehört zu den Qualitäten eines Musikers im Pop ja keineswegs nur das Handwerk. The Edge kann oder konnte keine Akkorde, Eddie van Halen keine Melodien, Ozzy konnte nie singen, dito Anthony Kiedis und eigentlich die allermeisten Hardrocksänger, daher mussten sie … wie Pete Towshend mit seiner hässlich grossen Nase: kompensieren. Und das ist im Grund die Story des Rock.
Kompensieren mit Kompositionen, die anders funktionieren, oder mit irrem Spiel (was ganz anderes, schaffen sich tausende Leser von Tabulaturen jeden Monat drauf … die schaffen dann sogar Sachen, bspw. Van Halen’s Beat-It-Solo, das hatte der selbst nie so gespielt, sondern Quincey Jones zusammengeklebt aus mehreren Aufnahmen …). Also, das sind sehr unterschiedliche Qualitäten, die Musiker/Bands letzten Endes zu etwas machen, das nachhaltig bei den Leuten im Kopf bleibt.
In dem Zusammenhang finde ich, müsstest du eigentlich auch mit den Musikern von Celtic Frost sprechen. Bzgl. Langzeitwirkung schon ziemlich fuckin phenomenal.
Matthias Wilde
Ich bin Autodidakt, und dies ist irgendwie befreiend, kann aber auch ein Hindernis sein. Gutes theoretisches Wissen erleichtert sicher das Lernen von weiteren Instrumenten und neuer Stile. Als Autodidakt besteht die Gefahr, dass man sich etwas im Kreis bewegt. Das ist natürlich auch bei gut ausgebildeten Musikern möglich und hängt auch von der Person ab, doch mit theoretischem Wissen kann man sich schneller in neue Situationen hereindenken, denke ich. Ach, was weiss ich! Alles hat seine Berechtigung, solange es Erfüllung gibt!
Micha Jung
Bei mir sind die Spielarten mit Menschen verknüpft, von denen ich sie lernte: Div.Flamenco-Stile von Maestro Ricardo Salinas, American Folkpicking von Martin Diem (Schmetterbänd), div. Fingerpickings (Leonard Cohen), E-Git (Schöre Müller), Rhythm. Guitar (Tucker Zimmermann, Joel Zoss) usw.
Michael Bucher
Ich habe vor meinem Studium autodidaktisch Gitarre gelernt, ich war zwar mal da und dort bei einem Lehrer, aber nie regelmässig und vermutlich hatte ich bis zum Studium 5 Lektionen. Ich bin wohl ein Antischulkind gewesen und habe noch heute Mühe zu verstehen, dass das, was man können möchte, in einer Schule zu holen sein soll. Ich bin auch Multiinstrumentalist, mische meine Aufnahmen oft selber, ebenso mache ich die Aufnahmen, mein Umfeld ist gross und willig bei Fragen Tipps zu geben, das Internet mit Wissen gestopft voll, so habe ich die meisten meiner Skills gelernt. Dafür gibts natürlich kein Diplom, gell. 😉
Trotzdem unterrichte ich dann und wann an der ZHDK, habe auch immer wieder Studenten, die zu mir in den Unterricht wollen. Das finde ich grossartig, die Auseinandersetzung mit den «Kids». Das Universum ist voller Äpfel, man muss sie nur pflücken.
Nick Werren
Auch ich: Kompletter Autodidakt. Dies kann hin und wieder, in Zusammenarbeit bzw. Zusammensein mit jazzgeschulten Freundinnen oder Mitmusikern, Komplexe auslösen und ich bezeichne mich in der Szene deshalb ungern als Musiker, obschon ich mich mein halbes Leben durch Musizieren ernährt habe.
Beim Musikunterricht und den Hausaufgaben meiner Kinder versuchte ich in den letzten Jahren möglichst viel nachzuholen. Inzwischen weiss ich, auf welcher Linie das C liegt, das hat mir aber irgendwie nicht viel gebracht.
Nikko Weidemann (ua. Moka Efti Orchestra in der Serie «Babylon Berlin»)
Ich habe am meisten von meinen Studenten (Studierenden) gelernt, als ich 10 Jahre lang Dozent war. Ohne je studiert zu haben. Vorher bin ich 4 Jahrzehnte immer mit der Wünschelrute dorthin, wo ich eine kreative Goldader vermutete. Ich glaube, dass das Sich-Neu-Erfinden-Müssen die wichtigste Quelle ist. Sich in eine Position zu begeben, aus der man nicht so einfach wieder rauskommt, das fordert einem das Beste ab.
Das Problem und das Siechtum des Jazz ist seine Verschulung, seine Akademisierung. Giant Steps als Einbahnstrasse, aus der es kein Entkommen gibt. Natürlich gibt es tradiertes Wissen, auch Keith Richards hat viel davon, aber er entzieht sich der Analyse. Bzw. sagt er in seinem tollen Buch ganz genau, wie seine open tunings sind, er deckt den «code» auf, macht ihn publik. Kann jeder haben und doch hat keiner Keef oder, for that matter, sich selbst, bis er oder sie bereit ist, den Preis zu zahlen.
Richard Koechli
Das hängt wohl vor allem auch mit dem Lerntyp zusammen (ich bin tendenziell mehr Autodidakt). Theorie zum Beispiel als grundsätzlich «hurting» für authentische Musik zu bezeichnen, wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich hab mir genau so viel Theorie draufgeschafft, wie ich für meine Arbeit (ziemlich dringend) nötig hatte – Feeling, Leidenschaft, feines Gehör usw. reichten bei mir nicht, um das Potenzial verwirklichen zu können. Die Theorie ist ein relativ kleiner, aber sehr wertvoller Teil für mich, um mich orientieren zu können in der Musik, um Dinge reproduzieren und kommunizieren zu können, um mich auch zu erden. Im richtigen Moment muss sie natürlich zurücktreten können, auf der Bühne vor allem. Ich bin schizophren genug und kann, mit Slidegitarre vor allem, auch vollkommen ahnungslos mich von Ton zu Ton schleichen, nur mit Gehör, Neugierde und Herz – aber ich kann vor allem beim Arrangieren und Entwickeln umso raffinierter (und reduzierter) arbeiten, wenn ich haargenau weiss, welche theoretische Funktion jeder Ton hat.
Ich glaube, das Problem ist, anscheinend gegensätzliche Dinge gegeneinander ausspielen zu wollen – das Autodidaktische und das Akademische zum Beispiel. In Wirklichkeit gibt’s davon Millionen von Mischformen. Kein Mensch dieser Welt ist ausschliesslich Autodidakt oder Akademiker. Jede und jeder holt sich auf individuellem Weg das nötige Rüstzeug, um auf seine Weise arbeiten zu können. Und jede und jeder kann von jeder und jedem sowieso lernen, ein Leben lang …;-)
Zum Emotionalen kann ich durchaus sagen, dass zu Beginn meiner Laufbahn als Berufsmusiker die Angst, nicht bestehen und genügen zu können, sehr gross war – und dass es Momente gab, wo ich mir mit allergrösster Sehnsucht irgendeine Ausbildung oder ein Diplom wünschte, welches mir diese Angst hätte wegzaubern können, ein Etikett «jetzt darfst du Berufsmusiker oder gar ‹Künstler› sein» sozusagen. Gleichzeitig wusste ich, dass mein Platz anderswo ist, dass ich an einer professionellen Jazzschule z.B. überfordert gewesen wäre – und so musste ich wohl oder übel lernen, diese Angst aus eigener Kraft zu überwinden. Ist mir gelungen, allerdings ehrlich gesagt auch wiederum nicht aus eigener Kraft – doch das … ist gleich noch ein anderes Thema 🙂
Roland Zoss
Für kreative spontane Musiker sind Noten hindernd. Ich kenne kaum Musiker aus dem Rock-Folk-Songwriter-Flamenco-Bereich die Noten aufschreiben. Persönlich musste ich nach einer Gesangsausbildung wieder lernen intuitiv-stimmungsvoll mit der Stimme umzugehen. Anstatt nur auf die Lautung zu achten. Aber: geblieben ist mir, darauf zu achten, REIN und ohne Druck auf die Stimme zu singen. Nebenbei hat sich dann noch ein absolutes Musikgehör entwickelt … Dank heigisch – Universum …
Saadet Türköz
Ich gehöre bestimmt zu den autodidaktischen Musikerinnen und Musikern als Improvisatorin, Stimmkünstlerin. Heute sehe ich dies diesen Weg – in dem ich ohne Noten Lesen, ohne musikalische (Bildung) als beglückend. Da sehe ich den Vorteil, weil man nach innen horcht, dadurch erhält man die eigene künstlerische Aussagekraft und Farbe. Der Nachteil finde ich einzig dann, wenn ich Anfragen bekomme, die mit geschriebenen Kompositionen zu tun haben. Ich finde dann schade, dass ich es absagen muss, vor allem wenn ich es ein interessantes Projekt finde.
Simon Hari alias King Pepe
– Inzwischen bin ich ein glücklicher Autodidakt.
– Das habe ich aber erst rausgefunden, nachdem ich mit vielen Profis zusammengearbeitet habe. Sie haben mir von ihren mühseligen Entlern-Prozessen berichtet.
– Bis ich diese Profis (und damit meine ich ausgebildete Musikerinnen und Musiker) kennengelernt habe, dauerte es aber viel zu lange. Und das wiederum hat damit zu tun, dass ich eben Autodidakt bin. Ich dachte immer: Jesses, ich Dilettant kann doch jetzt nicht richtig gute Musikerinnen oder Musiker für Zusammenarbeit anfragen. Ich kann ja nichts!
– Ich bin sehr froh, dass ich dann doch den Mut zusammengenommen habe und genau dies getan habe. Und da merkte ich auch: Was für eine schöne Ergänzung: Es ist nicht nur so, dass sie einiges können, was ich nicht kann (eh klar). Auch umgekehrt: ich kann einiges, was sie nicht können und durchaus zu schätzen wissen. (performen * nicht nur musikalisch, sondern auch konzeptuell denken: die ganze Geschichte erzählen wollen * unkonventionell arrangieren … to name a few)
– Unterwegs dazuzulernen hat natürlich nicht geschadet. Was mir dabei gefällt: ich habe mir Musiktheorie superselektiv angeeignet. Von vielem weiss ich immer noch nicht viel, aber in einigen Bereichen habe ich mich total naiv richtig drin verbissen und eine ziemlich eigene Sprache daraus entwickelt.
– Das könnte jeder ausgebildete Musiker bestimmt auch, aber vielleicht ist die Hürde höher, wenn es «Schulstoff» ist. Ich nahm dann ein Musiktheoriebuch zur Hand, und für mich war es wie ein Zauberbuch oooh, jetzt tauche ich in die geheimsten Geheimnisse der Musik ein, was für ein umwerfendes Gefühl.
Tom Best
Ich bin autodidaktischer Schlagzeuger. Deswegen und weil ich zwar schon lange, aber nie konstant am Instrument war, finde ich es schwierig, mich innerhalb der Drummer-Szene in Vergleich setzen zu können. Auch fehlt mir eine gewisse Systematik in der Lerngeschichte. Dafür lerne und übe ich einfach immer grade das, was mich fasziniert. Und muss insofern nicht die Bedürfnisse irgendeines Genres erfüllen – höchstens natürlich der Rock’n’roll-Band, in der ich spiele. Einerseits bin ich also gehemmt, mich mit den «Profis» zu vergleichen. Andererseits geniesse ich in meinem permanenten Laien- und Amateur-Status eine gewisse Narrenfreiheit …
Tot Taylor
I am totally self-educated – gtr, bass, piano, harpsichord, etc, synth, drums, cello, trumpet, French horn. Don’t read music. The ‘Ups’ outweigh the ‘Downs’. But there are ‘downs’. Prejudice mainly. It has simply meant I can make a varied album or recording all by myself whenever/wherever I like. But I love playing with other people, so usually make a BIG decision about each album before I begin. The current FRISBEE was mainly with Shawn Lee, Drums, Paul Cuddeford, guitar, Robbie Nelson and Joe Dworniak on engineering and mixing. Recorded at RAK London and at Riverfish Studios, Cornwall. In pre-production now for the new one, that will be exactly the same set-up.
Urs C. Eigenmann
Ich hab kein einziges Diplom. Spiele und komponiere seit gefühlten 100 Jahren Musik, war Klavierlehrer – Gabriela Krapf hat z. B. mit Best Musik-Matura an der Kanti Trogen abgeschlossen – und war Musik-, Theaterlehrer und Schulbandleiter an der Oberstufe Flawil. Habe viele Rundumelis aufgenommen und lebe immer noch glücklich und aktiv als Musiker und seit neuestem auch wieder als Veranstalter.
Ursus Lorenzo Bachthaler
Dazu gilt es pragmatisch zu sagen: Wenige Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker haben das dazu benötigte riesige Talent, heutzutage autodidaktisch in einer immer mehr akademisierten Jazzwelt bestehen zu können. Ich denke, dass heute 99 auf 100 professionelle Jazzmusiker ein Diplom machen, auch mit dem Hintergedanken, dass man so einen Wisch braucht in der Schweiz, will man später an einer Musikschule/Gymnasium/Hochschule unterrichten. Und von den Konzerten bestreiten nur die allerwenigsten ihren Lebensunterhalt. Die Musik, die durch diese Akademisierung entsteht, unterscheidet sich definitiv von der Musik, auf die fast all meine professionellen Jazzmusiker-Freunde immer zurückgreifen, wenn ihnen die Inspiration ausgeht 😉 Wir leben in anderen Zeiten, die andere Geister&eine andere Musik hervorbringen. Was ich persönlich aber als sehr schade empfinde, ist das sukzessive Wegfallen von Szeneorten, die spätabends in Form von Jamsessions soziale Knotenpunkte darstellen und talentierten Musikerinnen und Musiker so die Chance bieten würden, auch ohne akademischen Bildungsweg ihr musikalisches Rüstzeug zu erlangen resp. zu verbessern.