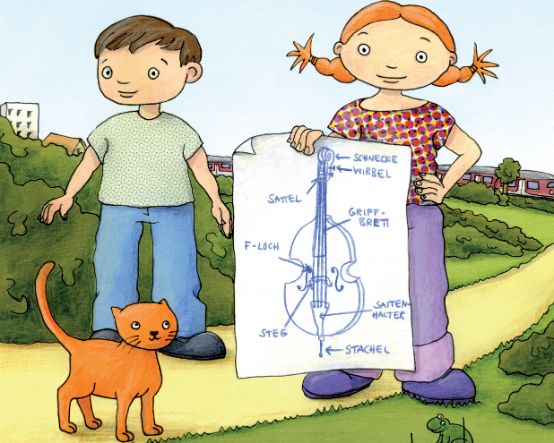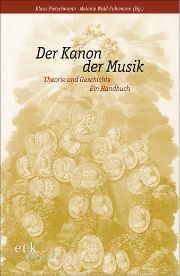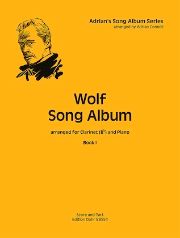Klingende Vergänglichkeit
Wie hat es die Musik mit Abschied, Trauer und Trost? Eine Erkundung über mehrere Jahrhunderte von Peter Gülke.

Wo Sie auch aufschlagen in den 54 kurzen Kapiteln von Musik und Abschied, machen Sie auf Schritt und Tritt Entdeckungen, die verblüffen, erhellen, das eigene Wissen bestätigen oder allenfalls auch zu Widerspruch reizen. Kein bequemes Thema, denn mit dem Abschied in der Musik ist vor allem der Tod gemeint – und der ist in den unterschiedlichsten Werken der Musikgeschichte präsent. Peter Gülke, der als Dirigent, Musikwissenschaftler und Lehrer in zahlreichen Publikationen Werke als Ganzes kommentiert hat, überblickt die Entwicklung vom Mittelalter bis in die Gegenwart auch in dieser speziellen Perspektive, holt die Beispiele so souverän heran und deutet sie so klar, oft auch mit Querverweisen zu literarischen Werken, dass man sofort darauf brennt, die Passagen erklingen zu lassen. Dazu sind allerdings in vielen Fällen die Partituren oder die Klavierauszüge (auch Chorpartituren) unerlässlich.
Damit wird offensichtlich, dass sich die Texte eher an «Eingeweihte» richten, denn oft sind es harmonische Entwicklungen oder nicht offen daliegende motivische Verbindungen, welche den Schlüssel zum Verständnis bieten. Eine vertiefte Betrachtung kann im Kapitel «Transzendiertes C-Dur» bei Gluck, Haydn oder Beethoven zur Erhellung beitragen. In «Totengedenken unter Musikern» werden Werke von Du Fay bis Kurtág unter gleichem Aspekt betrachtet oder, noch schonungsloser, im Kapitel «Musik für den eigenen Tod» auch Gesualdo, Froberger und Schostakowitsch.
Mit wenigen Sätzen gelingt es Gülke, etwa bei Schostakowitsch das achte Streichquartett mit seiner ersten und fünften Sinfonie und gleich auch mit dem d-es-c-h-Motiv zu verknüpfen oder mit treffsicherer Titelwahl der Erwartung ironisch vorzugreifen: «Land, das ferne leuchtet – Fahrkarten nach Orplid» oder «Tod mit und ohne Verklärung». Völlig überraschend ist die Parallelsetzung von Ferdinand Hodler und Leoš Janáček im Kapitel 47 mit dem Titel «Sterbeprotokolle», wenn er Hodlers Bilderzyklus der sterbenden Lebensgefährtin Valentine und Janáčeks Sprechmelodie-Notate von Artikulationen der sterbenden Tochter Olga – respektlos, aber nach überstandenem Schock bei der Überprüfung als doch genau zutreffend akzeptiert – als Ergebnisse «kreativer Gefrässigkeit» bezeichnet. Andererseits beschreibt er in diskretester Nachsicht Mahlers letztes Adagio und Skizzen zur zehnten Sinfonie unter dem Aspekt «Parallelismus von Musik und Leben»; die Umschreibung mit der «schaurig-grossartigen Grenzgängerei dieser Musik» verunmöglicht es, darüber hinwegzugehen, ohne die Takte 184 bis 212 des Adagios im Klangbeispiel zu hören..
Gülkes Formulierungen sind anspruchsvoll, seine Ausführungen ist reich an deutschen, lateinischen und französischen Zitaten, seine Vergleiche verlangen viel Allgemeinwissen, und nicht immer gelingt es auf Anhieb, seinen Gedankengängen zu folgen. Aber nur in wenigen Fällen kann man den Eindruck bekommen, die Sprache sei, am Thema gemessen, unnötig komplex. – Adornos Schreibe schimmert noch ab und zu durch: «Im Übrigen bildet die sorgsam aufrechterhaltene Inkohärenz den strukturellen Gegenpol zur nahezu choralhaften Komplexität der ‹Verklärung›, in die der nicht eben moribunde Impetus des Stückes sich rettet.»
Ergreifend direkt und sehr persönlich – in einem Fachbuch über musikalische Abschlussformulierungen völlig ungewöhnlich – sind die (auch drucktechnisch abgesetzten) ausführlichen Betrachtungen zum Tod, die zwischen Kapitelgruppen als «Selbstgespräche I–V» eingelegt werden: gedankenschwere Abschnitte zu Krankheit und Tod seiner Frau, mit der er fast 60 Jahre lang verbunden war; aber nicht nur dies, sondern auch weiterreichende Reflexionen über Gehenlassen und Alleinsein, die sich oft wieder mit der Musik verschränken, so dass die fachtechnisch besprochene Musik beim Weiterlesen näher an das eigene Verständnis vom Tod heranrückt und subkutane Wirkung erzielen kann.
Peter Gülke, Musik und Abschied, 362 S., mit Notenbsp. und Personen-/Werkregister, € 29.95, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 2015, ISBN 978-3-7618-2377-4, auch als E-Book erhältlich