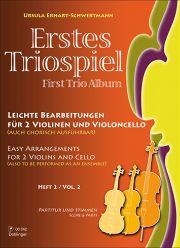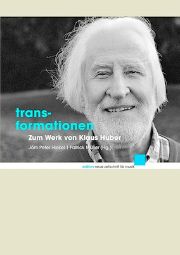Gezielte Provokation kann anregend wirken. Diese Wirkung wird jedoch verfehlt, wenn unsachliche Verallgemeinerung bzw. manipulative Darstellung Anwendung findet. Roman Brotbeck formuliert in der zweiten Hälfte seines Beitrags ein beherzigenswertes Anliegen: Er ermuntert zur vorurteilsfreien Beschäftigung mit Werken des Musiktheaters, deren angemessene Rezeption durch abwertende Äusserungen Richard Wagners blockiert oder behindert wurde. Die Darstellung dieses Anliegens hätte der vorangehenden Sätze nicht bedurft; diese lassen zunächst die Absicht vermuten, der Autor habe sich mit einigen provozierenden Betrachtungen der Aufmerksamkeit der Lesenden versichern wollen, geraten aber zu einer Folge von Unterstellungen und Halbwahrheiten.
Es mag methodisch korrekt sein, sich bei der Betrachtung von Person und Biografie Wagners nicht von dessen Wirkungsgeschichte beeinflussen zu lassen. Die Betrachtung von Wagners Wirkungsgeschichte kann dagegen nicht ausblenden, dass seine besondere Bedeutung in den Jahren des nationalsozialistischen Regimes nicht nur auf posthume Vereinnahmung zurückzuführen ist (wie sie etwa im Fall Anton Bruckners geschehen ist), sondern auch auf die Nähe von Strategien und Positionen. Die laut Brotbeck «raunend» und «beschwörend» vorgebrachte Formulierung «Urvater des Nationalsozialismus» stellt eine unzulässige Vergröberung dieses Zusammenhangs dar. Wenn sie sich tatsächlich in einer der von Brotbeck kritisierten Darstellungen nachweisen lassen sollte, so wäre das noch kein Grund, die Untersuchung der genannten problematischen Aspekte Wagners grundsätzlich für unnötig oder unangebracht zu erklären – es wäre allenfalls ein Grund, eine differenziertere Darstellung anzumahnen. Brotbeck erweckt in diesem Teil seines Textes den unglücklichen Eindruck, er wolle oder könne die Bewertung von Wagners Antisemitismus relativieren, da dessen militante Äusserungen in die Zeit vor Entstehung des Nationalsozialismus fallen. Es gibt jedoch (salopp gesagt) für diesen Antisemitismus keine «Gnade der frühen Geburt» (bzw. keine «Gnade des rechtzeitigen Todes»).
Die im letzten Satz des ersten Absatzes in ein drastisches Bild verpackte Unterstellung, die Auseinandersetzung mit Wagners Antisemitismus geschehe anstelle der wesentlich unbequemeren Untersuchung der Verbrechen der Nationalsozialisten, stelle demnach ein Ablenkungsmanöver oder eine Verdrängung dar, ist ebenfalls ungeheuerlich – zumindest, solange sie nicht in einem einzigen Fall belegt wird, d. h. solange sie als Vorwurf gegen die Gesamtheit der zu Wagners Antisemitismus Schreibenden gelesen werden kann. Da zu Beginn des Satzes allgemein von «Verbrechen» die Rede ist (nach der Erwähnung der «Massenmörder» im vorangegangenen Satz) stellt sich tatsächlich der Eindruck ein, Brotbecks pauschaler Vorwurf der Verdrängung oder mangelnden Aufarbeitung gelte dem Umgang (zumindest der Wagner-Kritiker) mit dem «Dritten Reich» im Allgemeinen – dass im folgenden Absatz des Textes ausschliesslich Beispiele aus dem Bereich der Musik genannt werden, impliziert jedoch, dass Brotbecks Bezichtigung nur den Umgang mit dem nationalsozialistisch dominierten Musikleben bezeichnet.
War im ersten Absatz von Wagner-Kritikern und (im Sinne des Titels der Ausführungen) von «Wagner-Hassern» die Rede (mit Seitenhieben auf das im «Wagner-Jahr» besonders umfangreiche Wagner-Schrifttum), so wird im zweiten Absatz der gegenwärtige Umgang mit musikalischen Protagonisten bzw. Erzeugnissen aus der Zeit des Nationalsozialismus anhand von drei Beispielen belegt, was im Kontext der Wagner-Thematik der anderen Teile des Textes allenfalls als Exkurs gelten kann. Hier werden Beispiele genannt, die nach Darstellung Brotbecks «landauf» und «landab» zu finden sind bzw. allgemein «in den Kirchen» (von denen es ja immer noch eine recht grosse Zahl gibt) – damit und mit der zuvor geäusserten Unterstellung einer von Verdrängung und Bequemlichkeit bestimmten Themenwahl erweckt Brotbeck verallgemeinernd den Eindruck, es habe bisher keine ernsthafte Beschäftigung mit Opfern, Profiteuren und Tätern der nationalsozialistischen Gleichschaltung des Musiklebens gegeben. Dieser Eindruck entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Es mag zwar sein, dass die Bearbeitung dieses Themas erst spät eingesetzt hat und auch nach der ersten umfassenden Publikation (Joseph Wulf: Musik im Dritten Reich – Eine Dokumentation, Gütersloh 1963) noch lange ein Thema von Aussenseitern geblieben ist; allerdings müsste Brotbeck bekannt sein, dass seit Beginn der 1980er-Jahre (seit Fred K. Priebergs Buch Musik im NS-Staat, Frankfurt/M. 1982, Neuauflage Köln 2000) eine grosse Zahl von Aufsätzen und Büchern zum Thema vorgelegt wurde. Die Auswirkungen dieser Studien auf Repertoire und Programmgestaltung sind nicht gross, da hier mehrheitlich von Musik die Rede ist, die als «nicht mehr neu, aber noch nicht alt» ohnehin weitgehend gemieden wird – immerhin konnte aber in Aufführungen und Editionen auf zahlreiche von den Nationalsozialisten verfemte, vertriebene, ermordete Komponisten hingewiesen werden (P. Ben-Haim [P. Frankenburger], H. Berlinski, B. Goldschmidt, E. I. Kahn, V. Ullmann u. a.). Diese Initiativen sind keineswegs an ein Ziel gelangt, sie sollten intensiviert, breit diskutiert und allgemein bekannt gemacht werden – es kann der aktuellen Situation aber nicht gerecht werden, die Bemühungen vorschnell in Abrede zu stellen, wie es im Text Brotbecks geschieht.
Zwei Leistungen können von den genannten Versuchen nicht erwartet werden: Eine Wiedergutmachung dessen, was den Verfolgten und Vertriebenen angetan wurde, und eine von weiterem Nachdenken befreiende eindeutige Einteilung aller Nicht-Verfolgten und Nicht-Emigrierten in «gut» (oder zumindest «unbelastet») und «böse». Viele Fälle werden seit Jahren kontrovers betrachtet – als Beispiel mag die Diskussion um Hugo Distler dienen, dessen widersprüchliches Verhalten bereits 1997 Gegenstand einer eigenen Publikation war (Stefan Hanheide [Hrsg.]: Hugo Distler im Dritten Reich, Osnabrück 1997). Auch Richard Strauss hat ein wechsel- und teilweise rätselhaftes Verhalten gezeigt, dessen Beschreibung in Lexikon-Artikel Eingang gefunden hat (vgl. wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss) – seine von Brotbeck erwähnte Präsidentschaft in den Anfangsjahren der Reichsmusikkammer verdient natürlich Kritik. Wie aber soll nach Meinung Brotbecks im Fall Strauss künftig verfahren werden? Soll auf Aufführungen seiner Werke verzichtet werden? Wagner, den Brotbeck in seinem ersten Absatz als zu Unrecht «geprügelten» Ururgrossvater darstellt, ist trotz der «Prügeleien» bis jetzt von solchen Massnahmen verschont worden: Die von Brotbeck für unangemessen erklärte Wagner-Schelte hat dessen Popularität und Präsenz auf den Spielplänen noch nicht wirksam einzuschränken vermocht.
Brotbeck bezeichnet Carl Orffs Carmina Burana als eines jener «nationalsozialistischen Propagandastücke», die auch heute häufig aufgeführt werden. Welches sind die anderen heute noch (oder womöglich heute wieder) geschätzten Propagandastücke? Wodurch eignen sich die Carmina Burana als Propagandastück – etwa durch die archaisierende Stilistik der Musik oder den Text? Wurde das Werk womöglich gezielt zum Zweck der Propaganda komponiert? Bis jetzt kann noch nicht einmal nachgewiesen werden, dass es tatsächlich als Propagandastück eingesetzt wurde. Die Uraufführung 1937 geschah im Rahmen des letzten Tonkünstlerfests, das der mit Beteiligung Franz Liszts gegründete «Allgemeine deutsche Musikverein» vor seiner erzwungenen Auflösung veranstalten konnte. Die Carmina waren erfolgreich, wirkten aber «anfangs genügend eigenwillig, um in den Kreisen von Rosenberg und sogar Goebbels verdächtig zu erscheinen» (Michael Kater: Die missbrauchte Muse – Musiker im Dritten Reich, München und Wien 1998, S. 363; ähnlich S. 352). Dagegen schreibt wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana_(Orff) über das Werk: «Speziell in der NS-Diktatur war es populär. Nazigrössen wie Hitler und Goebbels sagten die Carmina Burana von Orff besonders zu.» Als Beleg für diese auch in ihrer Diktion nicht restlos geglückte Darstellung wird allerdings nur eine Stelle des Buchs Adolf Hitler: A Psychological Interpretation of His Views on Architecture, Art, and Music von Sherree O. Zalampas (Bowling Green State Univ. 1990) genannt, wo es heisst «The melodies are quite folk-like in their simplicity and clear-cut stanzas. For these reasons perhaps, Hitler liked the work.» 1940 wurden die Carmina in Dresden von Karl Böhm dirigiert, der den Nationalsozialismus durch öffentliche Aufrufe aktiv unterstützt hatte, dagegen wurden während des Krieges Aufführungen in Görlitz abgesetzt auf Betreiben der nationalsozialistisch eingestellten Pianistin Elly Ney, die das Werk in Gegenwart des örtlichen NSDAP-Kreisleiters als «Kulturschande» bezeichnete (Prieberg S. 326).
Dieser notgedrungen kurze Überblick mag zeigen, dass die Einstufung von Orffs Erfolgsstück als nationalsozialistische Propagandamusik eine bedauerliche Überzeichnung und höchst eigenwillige Interpretation Brotbecks darstellt. Damit ist Orff nicht von seinen «Verstrickungen» freigesprochen: Er hat sich von staatlichen Stellen fördern lassen und Auftragsarbeiten geschrieben, etwa die Komposition Einzug und Reigen der Kinder für die Olympischen Spiele in Berlin 1936. Eine Bewertung ist im Einzelfall kompliziert: Als Orff zugesagt hatte, eine Bühnenmusik zu Shakespeares Ein Sommernachtstraum zu liefern, dürfte er gewusst haben, dass hinter dem Kompositionsauftrag der Versuch der Nationalsozialisten stand, Ersatz für die verbotene Bühnenmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy zu schaffen. Für Orff dürfte der Auftrag schon deshalb sehr attraktiv gewesen sein, da er nun eine Umarbeitung seiner bereits im Jahr 1917 – damals jedoch ohne politische Implikation und ideologische Motivation – zum gleichen Thema komponierten Musik vorlegen und vermarkten konnte.
Durch das erwähnte, zweifellos bahnbrechende und verdienstvolle Buch von Prieberg wurde im Jahr 1982 bekannt, dass Johann Nepomuk David die Motette Heldenehrung auf Worte Adolf Hitlers komponiert hatte. Die Mitteilung Priebergs führte damals zu Diskussionen und zum Rücktritt des Niederländers Cornelis van Zwol aus dem Präsidium der 1978 gegründeten «Internationalen Johann-Nepomuk-David-Gesellschaft». Hier seien einige Informationen zum Werk nachgereicht, fussend auf Forschungen und Publikationen von Bernhard A. Kohl: David vertonte den in anderen Quellen bisher nicht nachweisbaren Text: «Wer seinem Volke so die Treue hält, der soll selbst in Treue nie vergessen sein». Die Motette trägt die Widmung «Den gefallenen Lehrern und Studierenden der Staatl. Musikhochschule in Leipzig zum Gedächtnis» und wurde zweimal aufgeführt, zunächst am 7. November 1942 anlässlich einer Feierstunde der seit 1933 gleichgeschalteten Deutsch-Japanischen Gesellschaft – dies ist die von Brotbeck erwähnte Aufführung «vor diplomatischen Vertretern der Achsenmächte» – sodann am 27. März 1943 am selben Ort (in der Krypta des Völkerschlachtdenkmals) in einer Gedenkstunde für die gefallenen Lehrer und Studierenden, die im Rahmen der Feiern zum 100. Jahrestag der Gründung der Leipziger Hochschule (bis 1941 Konservatorium) stattgefunden hat. Vom Verlag Breitkopf & Härtel, in dem fast alle veröffentlichten Werke Davids erschienen sind, wurde die Komposition zwar für die beiden Aufführungen vervielfältigt, jedoch nicht publiziert: Es existiert kein Copyright-Vermerk und keine Verlags- oder Editionsnummer, so dass angenommen wird, dass David die Komposition nicht zur Veröffentlichung freigegeben hat. Zu den Umständen der Auftragserteilung und Textauswahl liegen keine amtlichen Zeugnisse vor, sondern nur eine Mitteilung Davids an Kohl, der David persönlich auf die Heldenehrung angesprochen hat, nachdem er – Jahre vor dem Erscheinen von Priebergs Musik im NS-Staat – auf den Titel gestossen war: Nach eigener Darstellung wurde David mit der Komposition beauftragt (dies wird von damaligen Schülern Davids bestätigt) und musste den Text aus einer Reihe von Vorschlägen auswählen, wobei alle übrigen Vorschläge «unbrauchbar» waren, also wohl stärker ideologisch befrachtet als das vertonte Zitat, bei dem die Urheberschaft mehr kompromittiert als der Wortlaut. In Stellungnahmen zweier damaliger Studierender der Leipziger Hochschule (publiziert 1983 in Heft 4 der Mitteilungen der Internationalen Joh.-Nep.-David-Gesellschaft) findet sich die Darstellung, dass es David peinlich gewesen sei, das Stück dem von ihm geleiteten Chor vorzulegen, und dass er um Verständnis für diese «Pflichtübung» gebeten habe.
Auch David hat finanzielle Förderung nicht zurückgewiesen: Im Jahr 1941 wurde ihm der «Gaukulturpreis des Gaues Oberdonau der NSDAP» verliehen. In Priebergs umfangreicher letzter Veröffentlichung Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945 (CD-Rom-Lexikon, Kiel 2004) wird für November 1943 Davids Beitritt zum bereits seit 1922 existierenden, aber längst gleichgeschalteten «Reichsbund Deutsche Familie» nachgewiesen. Dagegen legen viele Zeugnisse und Berichte über Davids Leipziger Zeit den Schluss nahe, dass dieser sich seine Unabhängigkeit gegenüber den herrschenden Ideologien bewahrt hat. Einige Beispiele: David hatte 1938 eine Aufführung von Strawinskys Psalmensymphonie durchgesetzt – explizit gegen ein Verdikt, das der «städtische NS-Kulturbeauftragte» ausgesprochen hatte; er hat sich für den Komponisten Günter Raphael eingesetzt, der als «Halbjude» angesehen wurde und über den ein Berufs- und Aufführungsverbot verhängt worden war. David wurde 1942 kommissarisch mit der Leitung der Hochschule betraut, doch nie offiziell zum Direktor des Instituts ernannt – dies wird im umfangreichen Wikipedia-Artikel zur Leipziger Musikhochschule falsch dargestellt. In seiner Eigenschaft als kommissarischer Leiter hat David bis Februar 1945 für die Aufrechterhaltung des Unterrichts- und Prüfungsbetriebs gekämpft. Es wird wohl nie ganz geklärt werden können, inwieweit die Heldenehrung und eventuell auch der genannte Beitritt zu einer gleichgeschalteten Institution als taktisches Vorgehen zu betrachten sind. Wie sehr sich David als Leiter der Kantoreien der Hochschule und als Komponist in seinem Einsatz für die Kirchenmusik behindert sah, belegt das Zitat aus einem Brief, den er im Sommer 1942, also im Jahr der Komposition der inkriminierten Heldenehrung, an seinen zur Wehrmacht eingezogenen Schüler Helmut Hilpert schrieb – hier heisst es nach der Aufzählung der neusten Instrumentalkompositionen Davids: «Für Chor zu schreiben ist nicht möglich, weil die Texte ja doch eigentlich verboten sind.» Diese Äusserung kann als Hinweis gelesen werden darauf, dass David die Heldenehrung auch zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht als gültiges Werk angesehen hat.
Dieser abermals kurze Überblick kann natürlich nicht dazu führen, Davids Wirken in der Zeit des «Dritten Reichs» zu glorifizieren (wie es andernorts tatsächlich versucht wurde), er mag aber doch zu der Einsicht führen, dass Brotbecks Bestreben, David in einer Beispielsammlung musikalischer Exponenten des Nationalsozialismus zu vereinnahmen, als unsachliche Verallgemeinerung anzusehen ist. Anfechtbar und tendenziös ist seine Darstellung nicht nur deshalb, weil sie Aufführungen von Davids Werken in die Nähe von Verdrängung und mangelndem Geschichtsbewusstsein rückt, sondern auch deshalb, weil sie den Eindruck erweckt, Davids Werke würden angesichts der angeblich mangelhaften Untersuchung der Biografie ihres Komponisten «in den Kirchen gesungen», also an vielen Orten und damit insgesamt recht häufig aufgeführt. Das Gegenteil ist der Fall: Aufführungen von Werken Davids stellen in der Kirche ebenso wie im Konzertsaal eine grosse Ausnahme dar, was angesichts der Qualitäten dieser Kompositionen bedauert werden muss. Die Diskussion um Davids Wirken in den Jahren des «Dritten Reichs» hat sich bereits in zweifacher Weise nachteilig auf die Häufigkeit von Aufführungen ausgewirkt: Einerseits wurde der Tatbestand Heldenehrung immer wieder ähnlich plakativ und undifferenziert genannt wie bei Brotbeck. Dabei hat sich ein zweifelhaftes «in dubio contra reum» erhalten, das in der Phase der ersten Auseinandersetzung mit dem Thema «Musik im NS-Staat» als emotionale Reaktion verständlich war, heute aber nicht mehr angemessen ist. Ein Beispiel für diese Verallgemeinerung aus der Erfahrung des Schreibenden: Ein renommierter Schweizer Organist hat in einem Gespräch über Musik des 20. Jahrhunderts geäussert, es sei sicher lohnend, sich mit den Orgelwerken Davids zu beschäftigen, sei aber «aus politischen Gründen» unstatthaft. – Andererseits wurde der tonal fundierten und häufig nach alten Mustern gearbeiteten Kirchenmusik der 1930er-Jahre in manchen Diskussionen pauschal eine stabilisierende Funktion und Wirkung gegenüber dem NS-Regime unterstellt – ohne Ansehung der Komponistenpersönlichkeit. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Äusserungen des Organisten und Komponisten Gerd Zacher in der Zeitschrift Musik und Kirche und an den von Michael Kater ausgesprochenen Generalverdacht gegenüber «der neuen Schule restaurativer Kirchenmusik» (S. 313). Die Werke Davids und vieler anderer Komponisten – auch ihre Kirchenmusik – entziehen sich solchen Etikettierungen. Erschreckend ist, dass hier manchmal ein Schubladen-Denken spürbar wird, das von ferne an peinliche Muster erinnert: Die Gleichsetzung, dass ein in Deutschland in jener Zeit tonal oder modal Komponierender mit Sicherheit ein «Nazi» gewesen sein müsse, funktioniert natürlich genau so wenig wie die in NS-Publikationen zu findende absurde Gleichsetzung, «atonale» Kompositionen müssten zwangsläufig das Werk eines jüdischen Komponisten sein.
Anliegen dieser Ausführungen ist es nicht, eine einzelne Persönlichkeit möglichst rein zu waschen, sondern eine differenzierte Betrachtung und Darstellung anzumahnen. Daraus erwachsen «spannende Aufgaben» für alle, die sich nicht mit dem Niveau von Stammtischparolen zufrieden geben wollen. Natürlich darf bei der Betrachtung der Geschichte nichts beschönigt oder ausgelassen werden – der Antisemitismus Richard Wagners ebenso wenig wie Zugeständnisse, politische Naivität, Anbiederung oder aktive Mittäterschaft von Musikern im NS-Staat. – Diese Ausführungen übersteigen das für einen Leserbrief übliche Mass, obwohl sie viele Aspekte nur in der Art eines Überblicks streifen. Damit die Form eines Leserbriefs gewahrt bleibt und der Text nicht noch länger wird, sind die bibliografischen Nachweise lückenhaft – diese können aber bei Bedarf gerne vollständig nachgereicht werden.
Matthias Wamser, Rheinfelden
wamserbaerthlein@sunrise.ch