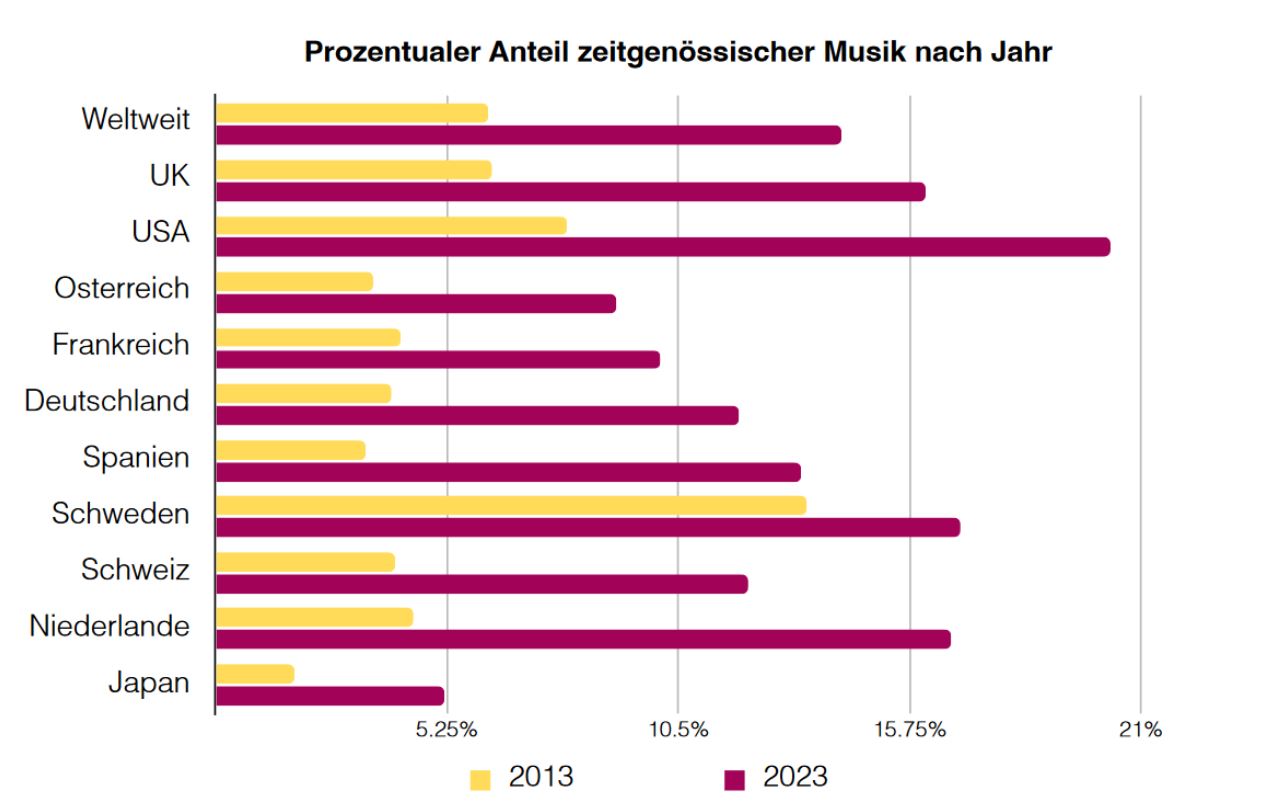Marcela Rahal gewinnt Gesangswettbewerb Tenor Viñas
Marcela Rahal, Mitglied des Luzerner Opernensembles, hat beim 61. Internationalen Gesangswettbewerb Tenor Viñas im Gran Teatre del Liceu, Barcelona den ersten Preis gewonnen.

Die brasilianische Mezzosopranistin Marcela Rahal studierte Gesang in Leipzig in der Klasse von Roland Schubert und in São Paulo bei Francisco Campos. Am Luzerner Theater debütiert sie im Frühjahr 2024 in der Titelpartie von Antonio Vivaldis Oper «Giustino»: Bereits ab dem 2. März ist sie als Brünnhilde in der Uraufführung von Samuel Penderbaynes neuem Bühnenwerk «Siegfried!» nach Richard Wagner zu sehen und zu hören.
Der Tenor Viñas Wettbewerb zählt zu den wichtigsten in den Gattungen Oper, Oratorium und Lied. Jedes Jahr nehmen junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt teil. Die internationale Jury besteht aus Fachleuten der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala, des Teatro Real Madrid, des Royal Opera House London und weiterer bedeutender Opernhäuser.