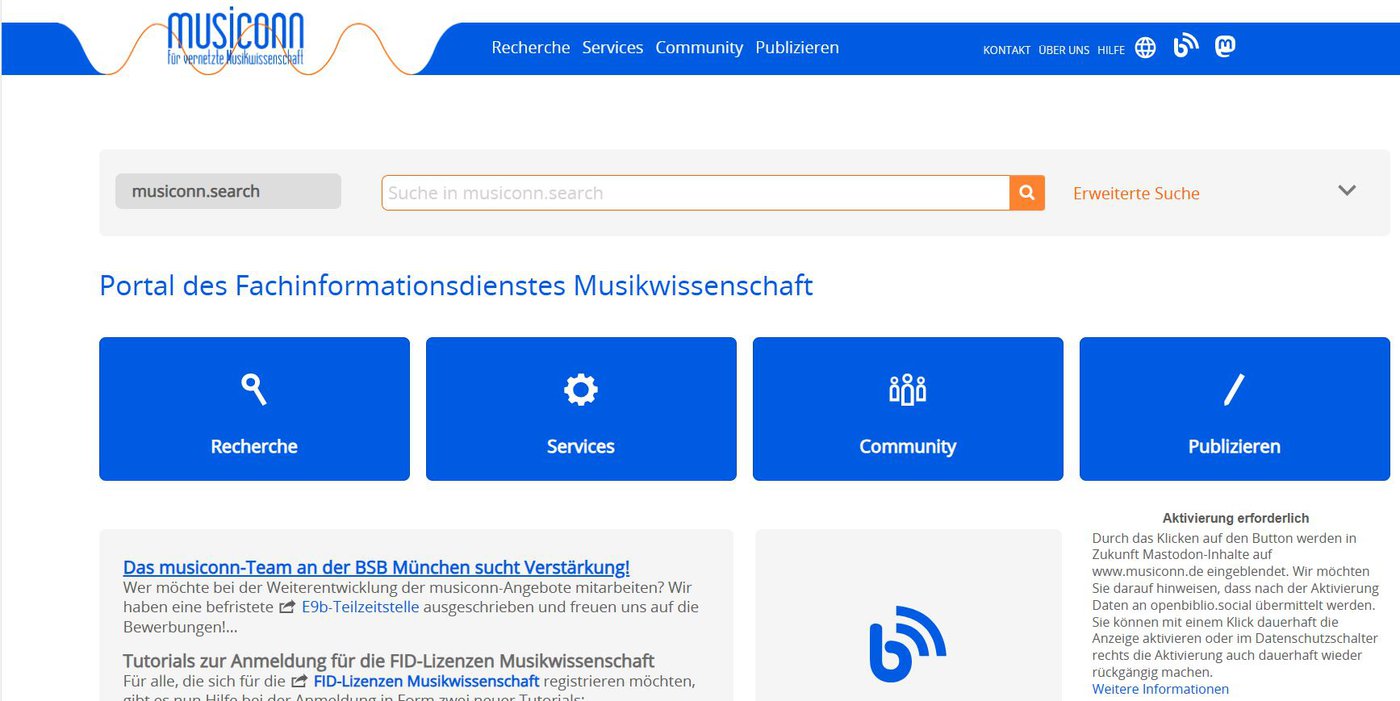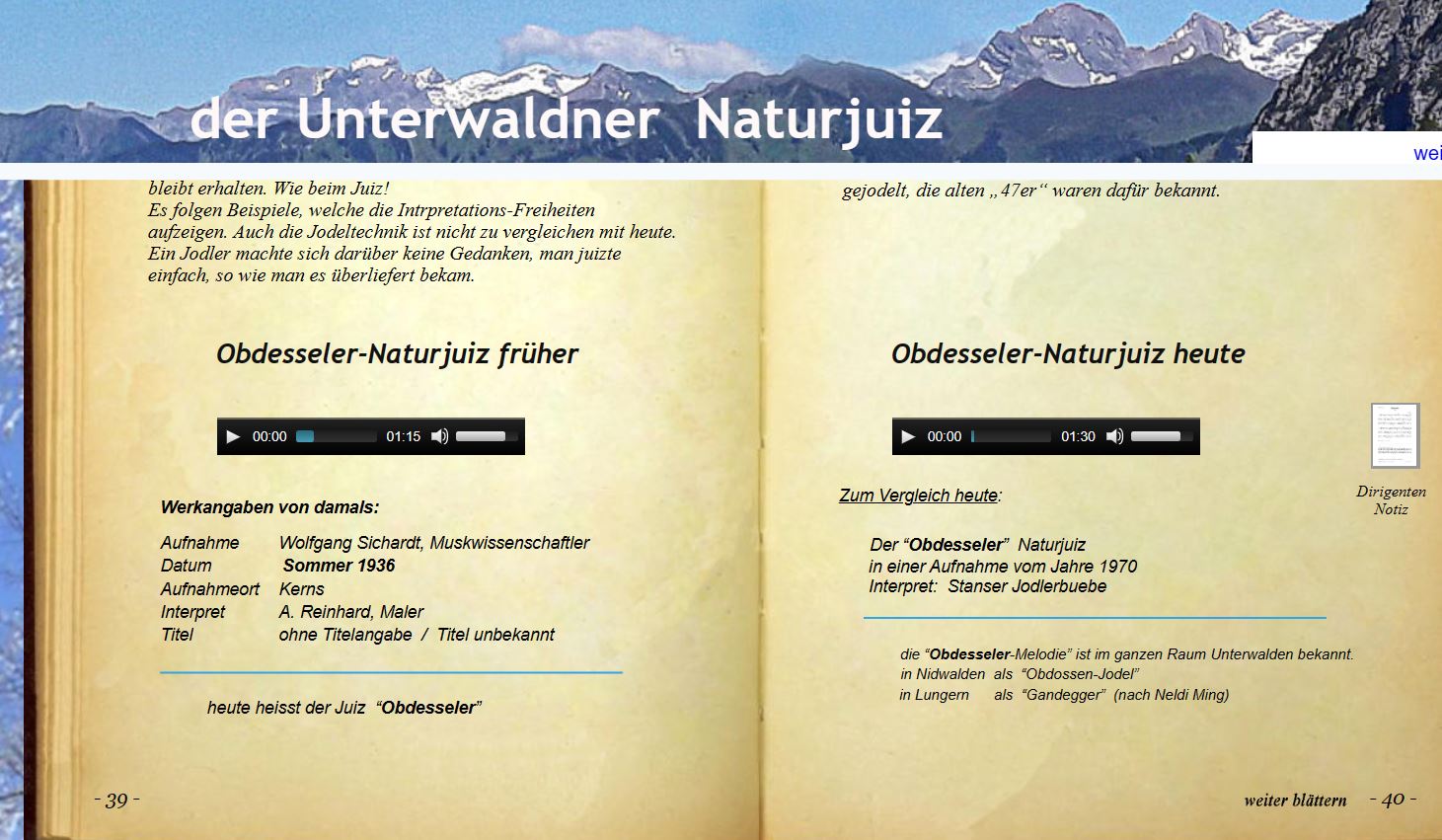Eve-Maud Hubeaux mit Karajan-Preis ausgezeichnet
Die Genfer Mezzo-Sopranistin Eve-Maud Hubeaux wird an den Osterfestspielen Salzburg mit einem Herbert-von-Karajan-Preis ausgezeichnet.

Eve-Maud Hubeaux wurde in Genf geboren und studierte Klavier am Konservatorium Lausanne, bevor sie dort ihr Gesangsstudium begann. Ihre internationale Karriere startete sie im Opernstudio der Opéra National du Rhin, nachdem sie einen Master in Vertragsrecht an der Université de Savoie abgeschlossen hatte. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, darunter des Internationalen Belvedere-Wettbewerbs (2013) und des 5. Internationalen Renata Tebaldi-Wettbewerbs.
Der seit 2017 im Rahmen der Osterfestspiele Salzburg verliehene Herbert-von-Karajan-Preis würdigt herausragende künstlerische Leistungen, die weltweite Anerkennung gefunden haben. Seit 2023 wird der Preis an drei Künstler, jeweils mit 16’000 Euro dotiert, verliehen. Neben Eve-Maud Hubeaux sind dies heuer Lise Davidsen und Masabane Cecilia Rangwanasha.