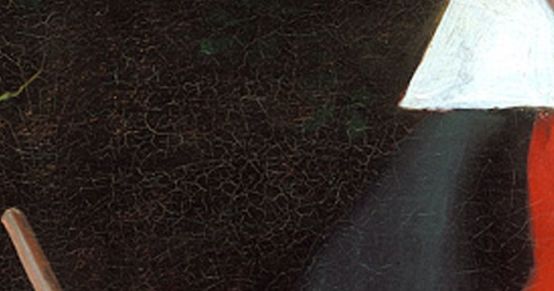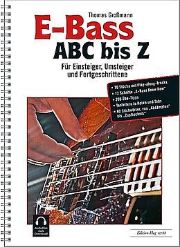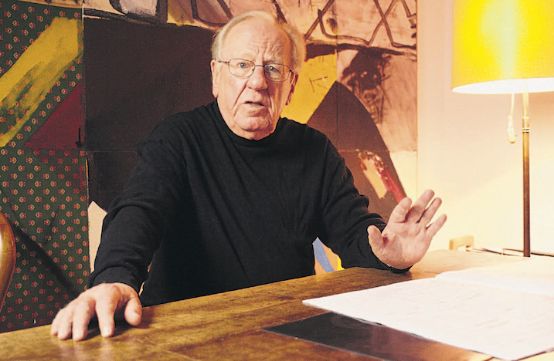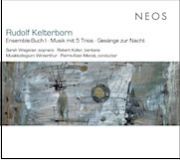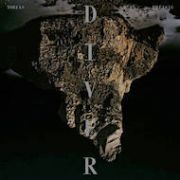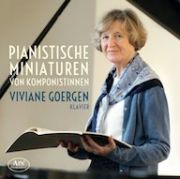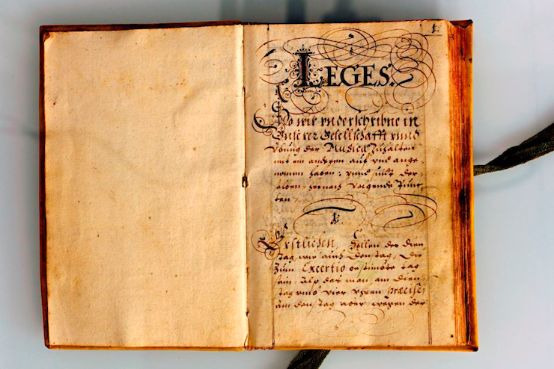Wer sich für die Musik von Komponistinnen interessiert, kennt sicher Germaine Tailleferre und Mel Bonis. Vielleicht hat man auch schon von der mährischen Komponistin Vítězslava Kaprálová oder der Elsässerin Marie Jaëll gehört, wahrscheinlich aber noch nie von Marguerite Roesgen-Champion, Otilie Suková-Dvořáková, Stephanie Zaranek, Vera Winogradowa oder Alicia Terzian. Alle diese Komponistinnen sind auf einer neuen CD der luxemburgisch-schweizerischen Pianistin Viviane Goergen vertreten. Sie hat in Nancy und Paris studiert und ist als Solistin und Kammermusikerin in zahlreichen europäischen Ländern aufgetreten. Ihr Repertoire umfasst nicht nur die Standardwerke, sondern auch Raritäten wie die Klavierwerke von Lyonel Feininger oder Ernst Toch. Dass sie sich jetzt unbekannter Klaviermusik von Komponistinnen widmet, ist sehr zu begrüssen. Walter Labhart, der für das Konzept ihrer CD mit mehreren Ersteinspielungen verantwortlich zeichnet, verfasste auch die kenntnisreichen Booklet-Texte.
Viviane Goergen hat ausschliesslich Miniaturen aufgenommen. La Cathédrale blessée von Mel Bonis ist mit einer Dauer von fünf Minuten das längste Werk. Mitten im Ersten Weltkrieg entstanden, ist das Stück mit dem unüberhörbaren Dies-irae-Motiv auch eine eindringliche Hommage an die durch Kriegshandlungen zerstörten Kirchen. Die Mehrzahl der kurzen Kompositionen hat aber eher einen heiteren und unbeschwerten Charakter, wie etwa die zwei Werke von Dvořáks früh verstorbener Tochter Otilie, die mit Josef Suk verheiratet war. Die in Paris lebende Genferin Marguerite Roesgen-Champion war in den Dreissigerjahren eine Pionierin des Cembalos. Ihre zwei Sätze aus den Bucoliques sind, wie Germaine Tailleferres Sicilienne, typische Werke des französischen Neoklassizismus. Würde man von Marie Jaëll nur ihre Valses Mignonnes kennen, hielte man ihre Musik für ziemlich harmlos. In den letzten Jahren sind aber zahlreiche Kompositionen der berühmten Klavierpädagogin eingespielt worden, die mehr Substanz besitzen.
Die Komponistin und Dirigentin Vítězslava Kaprálová aus Brünn schrieb 1937 für Rudolf Firkušný ihren Klavierzyklus Dubnová Preludia (April-Präludien), der trotz seiner Kürze eine Vielzahl an Stimmungen enthält. Er ist das kompositorisch raffinierteste und wahrscheinlich bedeutendste Werk auf der CD und wurde bereits mehrfach aufgenommen.
Die zwei Russinnen Stephanie Zaranek und Vera Winogradowa studierten beide unter anderem bei Maximilian Steinberg, dem Schwiegersohn Rimski-Korsakows. Ihre Klavierstücke, die in der jungen Sowjetunion entstanden sind, erinnern an die Musik von Prokofjew und Glasunow, ohne diese aber zu kopieren. Wesentlich später, nämlich 1954, komponierte die Argentinierin Alicia Terzian die stimmungsvolle Danza Criolla, die ihrem Lehrer Alberto Ginastera gewidmet und von der argentinischen Volksmusik inspiriert ist.
Viviane Goergens Interpretationen sind elegant und geschmackvoll, was besonders den ruhigen Stücken zugute kommt. Die schnellen Sätze könnten manchmal etwas flüssiger und mit mehr Temperament gespielt sein. Die CD ist allen zu empfehlen, die sich auch im Beethoven-Jahr für wenig bekannte Klaviermusik interessieren.
Pianistische Miniaturen von Komponistinnen. Werke von Mel Bonis, Marguerite Roesgen-Champion, Otilie Suková-Dvořáková, Vítězslava Kaprálová, Germaine Tailleferre, Marie Jaëll, Stephanie Zaranek, Vera Winogradowa und Alicia Terzian. Viviane Goergen, Klavier. Ars Produktion ARS 38 559